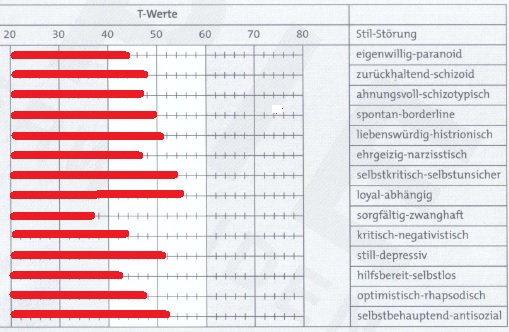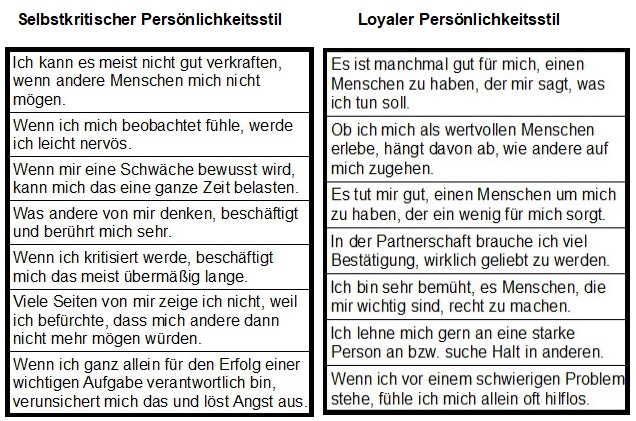Stress-Belastungen gibt es nicht erst seit Corona, doch sie haben im vergangenen Jahr deutlich zugenommen – Personalabteilungen, Coaches, Krankenkassen und auch Psychotherapeuten wissen ein Lied davon zu singen.
Gelegentlichen Stress verkraften die meisten Menschen problemlos. Schwierig wird es, wenn man sich einem permanenten Stress ausgesetzt sieht, weil man vielleicht nicht nur im Beruf, sondern auch im Privatleben unter großem Druck steht. Dann hat man auch keine Möglichkeit mehr, die Stress-Hormone, die der Körper unentwegt ausschüttet, wieder abzubauen. Gelegentlichen Stress kann man kompensieren, indem man sich bewegt, joggt, tanzt, schwimmt, Rad fährt, Krafttraining macht, was auch immer, und zusätzlich vielleicht noch Achtsamkeitstechniken wie Meditation oder ähnliches einsetzt. Diese Mechanismen versagen bei Dauerstress und die Folge davon kann ein Burnout sein. Burn-Out entsteht dann, wenn es zu einer länger andauernden Überschüttung mit Stress-Hormonen kommt.
Wie kommt es zu einem Burn-Out?
Verantwortlich für das Ausschütten von Stress-Hormonen ist die Amygdala. Hat man es mit Dauerstress zu tun, weil die Amygdala durch schwierige Situationen im Beruf und zu Hause permanent angeregt wird, den Körper mit Kortisol und Adrenalin zu überschwemmen, fehlen meist auch die Kraft und der Wille, sich durch Bewegung abzureagieren und zu regenerieren.
Die Erfahrung zeigt, dass bei einem Burn-Out für gewöhnlich das Zusammentreffen mehrerer belastender Faktoren gegeben ist. Es handelt sich nicht nur um eine Überlastung durch berufliche Anforderungen, sondern meist spielen auch starke Belastungen aus dem privaten Bereich eine Rolle. Wenn jemand zum Beispiel ein stark forderndes Projekt zu stemmen hat, während er gleichzeitig ein familiäres Problem bewältigen muss und vielleicht noch Geldsorgen hat, so bringt ihn das an die Grenze der psychischen Belastbarkeit.
Zu dieser ohnehin schwierigen Ausgangslage addieren sich oft noch psychologische Faktoren, zum Beispiel der Perfektionismus, der bei etlichen Führungskräften zu finden ist: Man hat den Anspruch, alles perfekt zu machen, am besten überhaupt alles selbst zu machen, denn nur dann ist man ja wirklich sicher, dass es gut gemacht ist. Trotzdem ist man nie zufrieden. Alle Verhaltensweisen, die mit dem beschrieben werden können, was die Transaktionsanalyse Antreiber nennt, also „Sei perfekt“, „Mach’s anderen Recht“, „Sei stark“, „Streng dich an“ und „Beeil dich“, bergen ein enormes Stress-Potenzial. Kann man seinem Antreiber nicht gerecht werden, löst das einen „inneren Alarm“ aus – ein Alarm, der signalisiert, „Achtung – Gefahr! Du verhältst dich nicht so, wie du sollst, die Dinge laufen schief, das gibt eine Katastrophe!“ Dieser innere Alarm bringt die Amygdala in einem Bruchteil von Millisekunden dazu, Stress-Hormone auszuschütten – denn das ist ihr Job: Den Körper durch Stress-Hormone zu außergewöhnlichen Leistungen zu befähigen, um Krisen zu bewältigen.
 Auch sogenannte Skript-Probleme, wie sie die Transaktionsanalyse beschreibt, die entstanden sind durch negative oder destruktive Botschaften, die man als Kind oder Jugendlicher empfangen oder zumindest so interpretiert und schließlich verinnerlicht hat, tragen durch den inneren Stress, den sie verursachen, zum Entstehen eines Burn-Out bei. Wurde jemand als Kind beispielsweise für die eigenen Leistungen ständig nur entmutigt, kann daraus der innere Zwang erwachsen, als Erwachsener permanent seine Fähigkeiten unter Beweis stellen zu müssen. Dieser innere Zwang zum permanenten „Gegenbeweis“ gegen die Botschaft „Du kannst nichts“ ist schon für sich genommen ein enormer Druck. Solange der „Gegenbeweis“ gelingt, d.h., solange man ausreichend äußere Erfolge vorweisen kann, ist das noch auszuhalten. Doch sobald derjenige sich überfordert fühlt und seine Strategie des Leistungsbeweises nicht mehr greift, kommt es zu einem Absturz. Das Gefühl der Überforderung löst immer mehr innere Alarme aus, was dazu führt, dass die Amygdala mehr und mehr Stress-Hormone ausschüttet.
Auch sogenannte Skript-Probleme, wie sie die Transaktionsanalyse beschreibt, die entstanden sind durch negative oder destruktive Botschaften, die man als Kind oder Jugendlicher empfangen oder zumindest so interpretiert und schließlich verinnerlicht hat, tragen durch den inneren Stress, den sie verursachen, zum Entstehen eines Burn-Out bei. Wurde jemand als Kind beispielsweise für die eigenen Leistungen ständig nur entmutigt, kann daraus der innere Zwang erwachsen, als Erwachsener permanent seine Fähigkeiten unter Beweis stellen zu müssen. Dieser innere Zwang zum permanenten „Gegenbeweis“ gegen die Botschaft „Du kannst nichts“ ist schon für sich genommen ein enormer Druck. Solange der „Gegenbeweis“ gelingt, d.h., solange man ausreichend äußere Erfolge vorweisen kann, ist das noch auszuhalten. Doch sobald derjenige sich überfordert fühlt und seine Strategie des Leistungsbeweises nicht mehr greift, kommt es zu einem Absturz. Das Gefühl der Überforderung löst immer mehr innere Alarme aus, was dazu führt, dass die Amygdala mehr und mehr Stress-Hormone ausschüttet.
Das allein muss nicht in einen Burn-Out münden, jeder gute Coach hat sich wahrscheinlich schon mit solchen Themen befasst, die im Coaching ohnehin häufig eine Rolle spielen: Also der Perfektionismus, das Beweisen-Müssen, wie gut man ist, oder das sogenannte Hochstapler-Syndrom, bei dem fähige und kompetente Menschen fürchten, bald würde der ganzen Welt offenbar werden, dass sie in Wirklichkeit gar nichts können. Kommen dann noch äußere Stress-Faktoren wie erhöhte Arbeitsbelastung oder anhaltende Verunsicherung wie durch die Pandemie und die damit verursachten unabsehbaren Veränderungen im Arbeitsleben dazu, wird der innere Druck immer größer.
Wenn jemand mit solchen Problemen zu kämpfen hat, so bedeutet zunächst einmal, dass man es mit einem gesunden Menschen zu tun hat, der an bestimmten Stellen wunde Punkte besitzt, die in der Amygdala Alarme auslösen. Es bedeutet nicht automatisch, dass er oder sie psychisch krank ist! Doch Menschen, die gerade einen Burn-Out erleiden oder akut davon gefährdet sind, bekommen häufig genau das als indirekt vermittelte Botschaft. Denn wenn eine Personal-Abteilung, Vorgesetzte oder nahestehende Personen den Eindruck gewinnen, dass jemand entweder schon an Burn-Out leidet oder erste Symptome anzeigen, dass dieser Fall bald eintreten könnte, ist das übliche Vorgehen, demjenigen eine Psychotherapie zu empfehlen. Also landen die Betroffenen häufig in einer psychotherapeutischen Praxis – oder noch häufiger zunächst auf der Warteliste einer solchen Praxis, denn Psychotherapeuten sind im Großen und Ganzen auf Monate hin ausgebucht. Das bedeutet eine unnötige Verlängerung ihrer Leidenszeit. Solche Probleme allein rechtfertigen auch keineswegs, einen Psychotherapeuten in Anspruch zu nehmen, der seine Zeit besser Menschen widmet, deren Symptome tatsächlich Krankheitswert besitzen. Es bedeutet einfach, dass die Menschen keinen Weg kennen, mit den inneren Alarmzuständen fertig zu werden.
Die Empfehlung, eine Therapie zu machen ist auch deshalb problematisch, weil eine Psychotherapie ihnen meistens nicht die Hilfe und Unterstützung bietet, die sie wirklich brauchen. Denn was sich im Coaching immer wieder gezeigt hat: Wenn jemandem ein Burn-Out droht, mangelt es oft auch an den richtigen Projektmanagement- und Selbstmanagement-Tools, weshalb sich ausschließlich auf der psychologischen Ebene ein Burn-Out meist nicht bewältigen lässt, jedenfalls, wenn man nachhaltige Ergebnisse erzielen will. Denn häufig tritt das Gefühl der Überforderung im beruflichen Bereich deswegen ein, oder geht auf jeden Fall damit einher, weil der- oder diejenige spürt oder fürchtet, dass wegen der großen Menge an Aufgaben der Überblick verloren geht. Dahinter steckt meist ganz einfach, dass er oder sie nicht mit den Tools arbeitet, die ein gutes Selbst-Management und ein erfolgreiches Projekt-Management ermöglichen. Solche Tools zu vermitteln dürfte wiederum die Psychotherapeuten überfordern, dafür sind sie für gewöhnlich nicht ausgebildet. Doch ohne die Klienten zu befähigen, ein hilfreiches Selbst- und Projektmanagement zu betreiben, hat man sie nach kurzer Zeit wieder vor sich. Sie kommen relativ schnell wieder in die gleiche Bredouille, wenn sie die Art und Weise, wie sie selbst und ihren Job organisieren, nicht ändern.
Was übrigens auch überhaupt nicht hilft, sind gute Ratschläge, die so manche selbsternannte „Burn-Out-Spezialisten“ von sich geben, zum Beispiel den „Die Dinge einfach nicht so an sich rankommen zu lassen“. „Na wunderbar“, denkt sich da der Burn-Out-Kandidat, „warum hat man mir das nicht schon früher gesagt! So ein Schrott, wenn ich wüsste, wie das geht, würde ich es freiwillig schon längst gemacht haben!“ Auch der väterliche Rat: „Sie müssen nicht perfekt sein!“ dürfte noch keinem einzigen Perfektionisten kurz vorm Burn-Out weitergeholfen haben. Es handelt sich schließlich selten um ein kognitives Problem – vom Verstand her ist wohl jedem klar, dass mehr innerer Abstand und weniger Perfektionismus guttun.
Kombination aus Selbstmanagement und Introvision Coaching
Es ist im Coaching ein empfehlenswerter Weg, bei Menschen, die unter starkem Stress stehen oder schon Burn-Out gefährdet sind, zuerst das Selbstmanagement zu erfragen. In manchen Fällen hat sich gezeigt, dass es genügte, mit den Klienten vernünftige Wege der Selbst- und Arbeitsorganisation zu erarbeiten, um ihnen den Druck zu nehmen. In einem Fall zum Beispiel war ein Manager schon auf dem Sprung, seinen Job hinzuschmeißen, was seine Firma in eine sehr schwierige Lage gebracht hätte, weshalb man ihm das Coaching ans Herz legte. Er hatte als anerkannter Spezialist die drei strategisch wichtigsten Projekte des Unternehmens zu verantworten und fühlte sich hoffnungslos überfordert. Er schlief nicht mehr, kam nicht mehr zur Ruhe, war kaum noch entscheidungsfähig und hatte den Spaß an der Arbeit verloren. Nach einer gründlichen Problemanalyse war klar, dass er seine Arbeitsorganisation verändern musste. Im Coaching erlernte er den Umgang mit einer Selbstmanagement-Software und wie er seine Projekte dort integrieren konnte. Schon nach der dritten Coaching-Sitzung fühlte er sich wieder gut in seinem Job, hatte die Projekte und Aufgaben im Griff, besaß den nötigen Überblick und hatte wieder Freude an der Arbeit. Laut eigener Aussage hatte der Coach ihm das Berufsleben gerettet.
Zu den ganz einfachen Selbstmanagement-Maßnahmen gehört zum Beispiel sich den Versuch des Multi-Taskings abzugewöhnen – schließlich ist es eine inzwischen anerkannte Tatsache, dass lediglich Mütter kleiner Kinder Multi-Tasking beherrschen. Beim Hin- und Herspringen zwischen Aufgaben, gehen Konzentration, Koordination und Überblick verloren – der Alarm springt an, der innere Druck steigt.
Das nächste ist der Umgang mit E-Mails. Wer dauernd seine Mails checkt, wird ständig in seiner Konzentration gestört und braucht deshalb mehr Zeit, um Aufgaben zu erledigen. Zweimal täglich Mails abzurufen genügt für gewöhnlich durchaus. Auch „Stille Stunden“, noch erstaunlich wenig weit verbreitet in deutschen Büros, sind sehr hilfreich, um zügig und konzentriert etwas abzuarbeiten.
Rückdelegationen zu erkennen und konsequent abzulehnen sollte für Führungskräfte selbstverständlich sein, ist es aber nicht… Rückdelegationen bewirken, dass Führungskräfte während ihrer Arbeitszeit mit den falschen Problemen beschäftigt sind. Statt nur ihrer eigenen, lösen sie auch noch die Probleme ihrer Mitarbeiter. Das führt zu zahllosen Überstunden, zu mehr Verantwortung, mehr Druck, mehr Stress.
Und last but not least fällt es vielen Führungskräften schwer, ihre Prioritäten richtig zu setzen. Besonders die berühmte 80/20-Regel fällt zu oft unter den Tisch. Die besagt, dass man mit 20% der Aufgaben 80% seines Erfolges sicherstellt. Deshalb ist es so wichtig, die Aufgaben herauszufinden, die wirklich wesentlich zur Zielerreichung beitragen.
Dass man gar nicht nach psychologischen Faktoren suchen muss, wie im oben angeführten Fall, ist allerdings eher die Ausnahme. Oft genug stecken innere Glaubenssätze oder Befürchtungen dahinter, die jemanden etwa veranlassen, sich viel zu viel Arbeit aufzuhalsen, die Mitarbeiter zu Rückdelegationen quasi zu ermutigen, oder sich auf irgendeine Art und Weise so viel inneren Druck zu machen, dass es, zusammen mit dem äußeren Druck, zu einer Überforderung und schlimmstenfalls zum Zusammenbruch kommt. Dann ist es für einen guten Coach unerlässlich, auf die psychologische Seite einzugehen. Dazu braucht man jedoch nicht auf eine tiefenpsychologische Reise in die Lebensgeschichte der Klienten zu gehen. Im Coaching hat sich nach unserer Erfahrung am besten die Introvision bewährt, um Klienten schnell und dauerhaft von ihrem Stress zu befreien.
Introvision wurde als Methode an der Uni Hamburg im Fachbereich Pädagogische Psychologie entwickelt, um den Stress von Lehrern zu reduzieren. Das war als eher langwieriges Verfahren jedoch nicht geeignet fürs Coaching. Doch in dem Format, wie es von der dehner academy als Introvision Coaching weiterentwickelt wurde, lässt es sich hervorragend im Coaching einsetzen und führt fast immer schon nach ein bis zwei Sitzungen zu spürbaren Ergebnissen, die die Klienten erleichtern und ihnen ihre Handlungsfähigkeit zurückgeben.
Während der Forschung, die zu Introvision gemacht wurde, hat sich gezeigt, dass Alarme und damit Stress durch das Zusammenwirken von „Imperativ“ und „Befürchtung“ ausgelöst werden. Ein innerer „Imperativ“ fordert entweder, dass etwas entweder auf jeden Fall zu geschehen hat („Ich muss diesen Auftrag bekommen!“ / „Ich muss für Harmonie sorgen!“ / „Ich muss gemocht werden!“ u. ä.) oder aber, dass etwas auf gar keinen Fall passieren darf („Ich darf dieses Projekt unter keinen Umständen vermasseln!“ „Ich darf nicht scheitern!“ „Ich darf die Anerkennung der anderen nicht verlieren!“ „Ich darf nicht abgelehnt werden!“ u.ä.) und dass zu diesem Imperativ, der den Menschen selten spontan so bewusst ist, als erster innerer Stimme eine zweite hinzukommt, die suggeriert, dass genau das eintreten könnte, was nicht sein darf. Wie ein leises Hintergrundraunen ist ständig die Befürchtung da: „Es könnte sein, dass ich den Auftrag nicht kriege“ oder „Es könnte sein, dass ich mit diesem Projekt scheitere“, „Es könnte sein, dass mich die anderen ablehnen“. Und meist geht das weiter mit „…Wenn ich nicht … tue“ Dieses „wenn ich nicht“ beschreibt die „Lösungs-Strategie“ die man sich irgendwann, häufig, aber nicht zwingend, schon als Kind angeeignet hat: „Wenn ich mich nicht wahnsinnig anstrenge“ / „Immer perfekt bin“ / „Es den Anderen Recht mache“.
Es lässt sich leicht vorstellen, dass jemand, der beispielsweise ein schwieriges Projekt zu bewältigen hat, bei dem einiges nicht funktioniert, weil der Kunde immer mal wieder unzufrieden ist, weil Termine nicht eingehalten werden können, weil es zu Fehlern kommt, zunehmend stärker unter Druck gerät, weil sein Imperativ „Ich darf bei diesem Projekt nicht scheitern!“ immer mehr von seiner Befürchtung, doch noch zu scheitern, konterkariert wird.
Ist der Imperativ durch solche Befürchtungen bedroht, wird in der Amygdala in Sekundenbruchteilen ein Alarm ausgelöst: „Achtung, höchste Gefahrenstufe, es muss was getan werden!“ Also wird die Stresshormon-Ausschüttung ausgelöst, weil Adrenalin und Kortisol Menschen sofort zu Höchstleistungen befähigen. Leider ist einem Projektmanager mit dem, wozu ihn Stresshormone am besten befähigen, nämlich verdammt schnell zu rennen, nicht gedient. Und weil er vor lauter Stress auch in seiner Freizeit nicht mehr rennt, lagern sich die Stresshormone im Körper an und sorgen für Schlaflosigkeit, Unruhe, Nervosität, Mangel an Konzentration, was im schlimmsten Fall zum Burn-Out führt.
Die Amygdala reagiert auf das, was sie als Gefahrensignal wahrnimmt, unvergleichlich schnell, etwa zweihundert Mal schneller als das Großhirn, in dem die Ratio beheimatet ist. Diese blitzartige Alarmfunktion ist für uns Menschen im Großen und Ganzen ein Segen – in diesem besonderen Fall allerdings eher ein Fluch. Hat jemand in einer guten psychosomatischen Klinik in einem mehrwöchigen Aufenthalt durch den physischen Abstand zu seiner Arbeit auch inneren Abstand gefunden, wird er oder sie nach der Rückkehr in den Alltag unter Umständen sehr bald wieder mit den gleichen Problemen und Symptomen wie vorher konfrontiert sein. Wie gesagt, die Amygdala reagiert auf die auslösenden Reize um ein Vielfaches schneller als das kognitive Bewusstsein. Das heißt, bevor man sich auch nur den ersten Halbsatz der Stress-Bewältigungs-Strategien, die man gelernt und verstanden hat, vorsagen kann, ist die Stresshormon-Ausschüttung schon passiert.
Was jedoch wirklich hilft: Die Alarme zu löschen! Dafür hat sich Introvision Coaching bislang am besten bewährt. Sind die Alarme gelöscht, kehrt auch die Gelassenheit zurück. Durch kognitive Erkenntnisse, wie sie mit psychotherapeutischen Methoden erzielt werden, lassen sich zwar Verbesserungen erzielen, doch sie löschen die Alarme nicht, weshalb die alten Probleme wiederkehren, wenn die Trigger nur stark genug sind. Deshalb nützen auch die vernünftigen Überlegungen, die man sich in ruhigen Momenten macht, nichts, wenn man sich wieder in einer Situation befindet, die einen Alarm auslöst – sie kommen einfach zu spät. Für die Amygdala genügt schon eine Übereinstimmung von nur 10- 15 % Prozent mit alten Erfahrungen, dass die Situation sich genauso entwickeln könnte, wie sie es keinesfalls darf, um alarmiert zu sein und die Stresshormone abzufeuern.
Auch wenn man über die lebensgeschichtlichen Zusammenhänge Bescheid weiß, also dass etwa der strenge Vater, der inkompetente Lehrer, der schreckliche erste Chef oder ein sonstiger Umstand dazu geführt hat, dass man jetzt Herzklopfen bekommt, weil man Angst hat, man könnte versagen, hilft das nicht weiter, ohne Stress mit der Situation umzugehen. Denn die lebensgeschichtlichen Zusammenhänge, die es selbstverständlich gibt, sind zwar ganz interessant, tauchen in der Arbeit mit Introvision Coaching auch auf, doch sie sind nicht entscheidend für das Löschen der Alarme. Statt also nach lebensgeschichtlichen Zusammenhängen zu forschen, weshalb sich jemand unter Druck setzt, ist es viel wichtiger, direkt an die Alarme heranzukommen, und die zu bearbeiten.
Die Logik dahinter, ist folgende: Alarme dienen dazu, Handlungen auszulösen! Sie haben keinen Sinn an sich, sondern nur den Zweck, etwas anderes zu bewirken. Die Sirenen der Feuerwehr sollen alle anderen zum Platzmachen bewegen, der Alarm bei einem Einbruch ruft die Polizei, der Feueralarm in einem Gebäude bedeutet „Alle schnellstmöglich raus hier!“ Ein Alarm, der keine Handlung auslöst, ist sinnlos, man kann ihn auch bleibenlassen.
Für die Alarme, von denen wir sprechen, bedeutet das, solange der Alarm noch eine Reaktion bewirkt, man hektisch wird, aufgeregt, nach Lösungen oder Scheinlösungen sucht, sein Gedankenkarussell kreiseln lässt usw., solange scheint er „sinnvoll“ zu sein. Deshalb war es ein Geniestreich von Professor Angelika Wagner an der Uni Hamburg, sich zu fragen „Was passiert eigentlich, wenn man die Menschen den Alarm einfach mal nur beobachten lässt? Wenn man sie anleitet, den Alarm über sich ergehen zu lassen, ohne den geringsten Versuch, irgendetwas dagegen zu tun?“
Wenn sie mit der richtigen Technik angeleitet werden, erleben Menschen dabei etwas Verblüffendes: Der Alarm legt sich peu á peu, wird schwächer, bis er schließlich ganz verschwindet. Das liegt an seiner Natur: Er soll ja Handlungen auslösen. Wenn keine „Handlungen“ mehr erfolgen, wird auch der Alarm, der jedes Mal eine Menge Energie kostet, überflüssig. Das menschliche Gehirn, seinem Wesen nach ein „Energiespar-Modell“, unterlässt den Alarm schließlich, wenn der Mensch mit der Situation konfrontiert wird, die ihn früher so gestresst hat. Ohne Stress kann er oder sie wieder klar denken, bessere Entscheidungen treffen, hat seine Souveränität und Gelassenheit zurück.
Das konkrete Vorgehen in Kürze
Im Introvision Coaching muss zunächst der genaue Imperativ herausgearbeitet werden. Von entscheidender Bedeutung ist, den Imperativ mit der haargenauen Wortwahl des Klienten zu ermitteln. Im nächsten Schritt wird daraus der Satz formuliert, der diesen Imperativ am treffendsten bedroht, der also genau die Befürchtung, was nicht sein darf, zum Ausdruck bringt. Auf diesen Satz kommt es in der Arbeit entscheidend an, denn er muss den inneren Alarm auslösen. Da kann es einen großen Unterschied machen, ob der Imperativ lautet „Ich darf nicht versagen“ oder „Ich darf nicht scheitern“ – auch wenn es der Sache nach auf das Gleiche hinausläuft.
Bevor die Arbeit mit dem Alarm beginnen kann, müssen Klienten jedoch erst den wichtigen Schritt erlernen, ohne den Introvision Coaching nicht funktioniert. Der Coach muss den Klienten beibringen, wie sie die Haltung der weiten Wahrnehmung einnehmen können, die es ihnen erst ermöglicht, den Alarm einfach ablaufen zu lassen, rein beobachtend, ohne irgendwie gedanklich einzugreifen. Mit Hilfe der weiten Wahrnehmung sind Klienten in der Lage, das was Alarme alles bewirken – auf der Körperebene z.B. Spannung, Druck in der Brust, Verkrampfungen, im mentalen Bereich etwa Gedankenkreiseln oder fieberhaftes Überlegen, und emotionales Geschehen, etwa Angst, Trauer, Wut oder Zorn – einfach nur zu beobachten. Es geht darum nichts zu bewerten, nichts verändern, nichts lösen zu wollen, denn das alles ist ein „Eingreifen“ und gibt dem Alarm neue Nahrung. Die Klienten lernen zunächst das, was im Mindfulness Based Stress Reduction Programm „Achtsamkeit“ genannt wird. Mit der richtigen Anleitung gelingt das meist sehr schnell.
Wenn die Klienten die Haltung der weiten Wahrnehmung einnehmen können, konfrontiert der Coach sie mit dem Satz, der ihren Alarm auslöst. Der Alarm muss ausgelöst und er muss erlebt werden, sonst ist die Arbeit mit Introvision Coaching nicht möglich. Die Klienten bleiben so lange in der Haltung der weiten Wahrnehmung, wie es ihnen möglich ist, aber nicht länger als zehn Minuten. Sie bewerten die Höhe des Alarms auf einer Skala von eins bis zehn – und beobachten dann ihre Reaktionen auf den Satz. In diesem ersten Setting erleben die meisten Klienten schon eine Verringerung des Alarms. Bei einem zweiten Setting reduziert sich der Alarm für gewöhnlich noch weiter.
Damit ist die Arbeit aber noch nicht zu Ende. Die Klienten erhalten als Hausaufgabe, täglich selbst weiter zu üben. Dazu erhalten sie vom Coach die Aufnahme, die während des ersten Settings gemacht wurde. Die Arbeit muss so lange wiederholt werden, bis der Alarm bei null ist, oder bis zur nächsten Coaching-Sitzung, bei der man mit dem Coach weiter arbeitet. Der Alarm muss bei null ankommen, sonst ist er nicht dauerhaft gelöscht und baut sich womöglich wieder auf.
Klienten berichten nach der Arbeit mit Introvision Coaching immer wieder, wie erstaunlich und verblüffend für sie die Erfahrung ist, eine vorher so stressige Situation plötzlich souverän und rational bewältigen zu können.
Ganz allein mit sich selbst Introvision Coaching zu machen, wenn man noch nie eine Anleitung erhalten hat, funktioniert leider meist nicht besonders gut. Es scheint vor allen Dingen nicht leicht zu sein, tatsächlich den oder die richtigen Imperative zu identifizieren. Eine hilfreiche Möglichkeit, mit einer stressigen Situation umzugehen, ist jedoch, sich ein wenig Zeit und Ruhe zu nehmen und die Frage „Was ist das, was mich daran wirklich stresst?“ nach innen sinken zu lassen und, ohne aktiv danach zu suchen, zu warten, welche Antworten auftauchen. Also nicht überlegen oder grübeln, sondern einfach die Antworten kommen lassen – vielleicht ist eine Überraschung dabei.

Renate Dehner
Literaturhinweise:
- Renate Dehner & Ulrich Dehner (2019). Steh dir nicht im Weg – Wie Sie mentale Blockaden überwinden und sich das Leben leichter machen (3. komplett überarbeitete und ergänzte Auflage). Campus Verlag. → Rezension
- Ulrich Dehner & Renate Dehner (2016). IntrovisionCoaching. managerSeminare Verlags GmbH. → Rezension
- Ulrich Dehner & Renate Dehner (2013). Transaktionsanalyse im Coaching. managerSeminare Verlags GmbH, Bonn. → Rezension
Seit mehr als 30 Jahren unterstützt die dehner academy mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Hervorgegangen aus den Konstanzer Seminaren, die Dipl.-Psych. Ulrich Dehner 1986 gründete, ist die dehner academy heute Experte für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebs-Trainings, Business- und Life-Coachings und in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler.
dehner academy GmbH | Theodor-Heuss-Str. 36 | 78467 Konstanz
Telefon: +49 7531 942008-0 | E-Mail: info@dehner.academy | https://www.dehner.academy/
Hier finden Sie Psyche und Arbeit bei Facebook.
 „Wir irren allesamt, nur jeder irret anders.“ Georg Christoph Lichtenberg
„Wir irren allesamt, nur jeder irret anders.“ Georg Christoph Lichtenberg







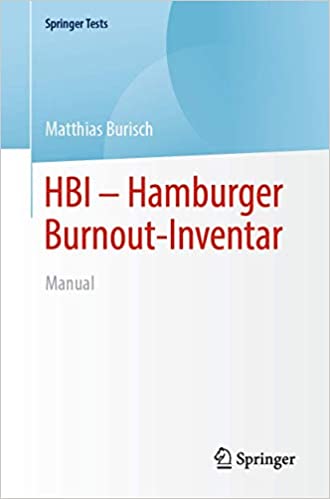

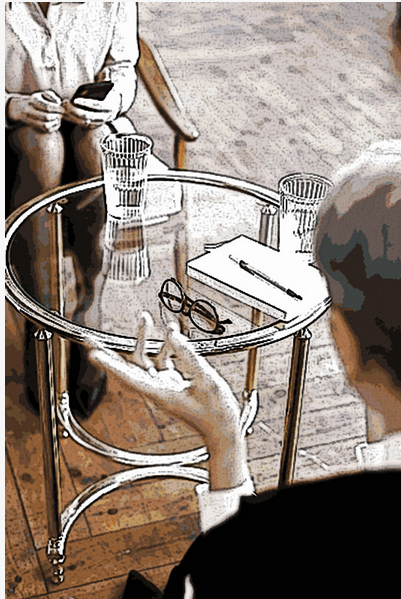
 Dr. Uwe Peter Kanning ist seit 2009 an der Hochschule Osnabrück Professor für Wirtschaftspsychologie. Als Personaldiagnostikexperte setzt er sich für evidenzbasiertes Personalmanagement ein und klärt über Pseudowissenschaften in der Personalauswahl und im Personalmanagement auf.
Dr. Uwe Peter Kanning ist seit 2009 an der Hochschule Osnabrück Professor für Wirtschaftspsychologie. Als Personaldiagnostikexperte setzt er sich für evidenzbasiertes Personalmanagement ein und klärt über Pseudowissenschaften in der Personalauswahl und im Personalmanagement auf.