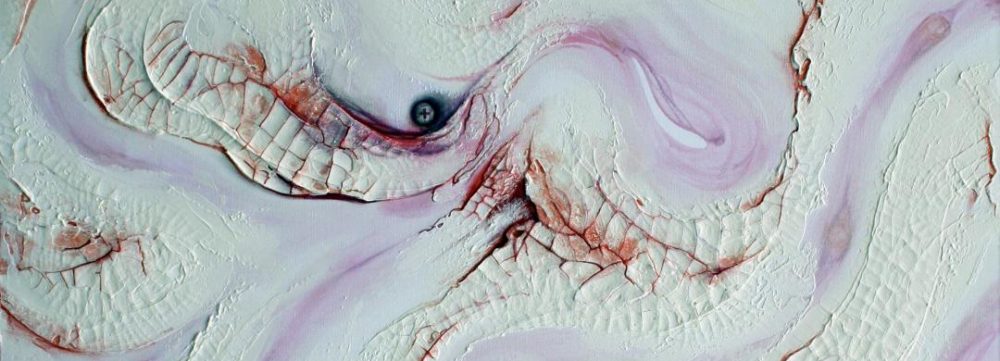Dr. Jürgen Kriz ist approbierter Psychologischer Psychotherapeut und emeritierter Professor für Psychotherapie und Klinische Psychologie an der Universität Osnabrück, hatte aber auch an zahlreichen Universitäten Gastprofessuren. Er erhielt u. a. den Viktor-Frankl-Preis (2005), den AGHPT-Award (2014) und den Ehrenpreis der Gesellschaft für Personzentrierte Psychotherapie und Beratung (2016). Im Jahr 2020 wurde ihm für seinen Einsatz für die Förderung der Humanistischen Psychotherapie in Deutschland sowie für die konsequente Umsetzung humanistischer Werte das Bundesverdienstkreuz verliehen. In diesem Interview beantwortet er einige Fragen zur Personzentrierten Systemtheorie sowie zur Psychotherapie im Allgemeinen.
 Warum wollten Sie damals eigentlich Psychologe werden?
Warum wollten Sie damals eigentlich Psychologe werden?
„Psychologe“ – im heutigen Verständnis – wollte ich gar nicht werden; denn damals gab es noch gar kein Berufsbild „Psychologe“. Auch hatte ich sehr unklare Vorstellungen darüber, wie ein Psychologiestudium aussehen würde, als ich damit begann. Die letzten Jahre vor dem Abitur war für mich und meine Umwelt klar, dass ich Musik studieren würde. Das habe ich dann aber wenige Wochen vor Semesterbeginn in einer überraschenden Bauch-Entscheidung verworfen – was im Nachhinein sehr klug war, weil ich dann bestenfalls am 5. Pult eines drittklassigen Orchesters gelandet und versauert wäre. Meine eher begrenzten Fähigkeiten und Möglichkeiten wurden mir schlagartig klar, als es mit dem Musikstudium Ernst werden sollte.
Da ich als Kind einer Kriegerwitwe aber kein Geld für Bedenkzeit hatte, musste ich mich innerhalb weniger Wochen entscheiden. Vom Psychologiestudium hatte ich gehört, dass man damit später sehr viel Unterschiedliches machen kann. Das gab den Ausschlag. Und so bin ich in ein Studium gestolpert, das sich für mich als Glücksfall erweisen sollte.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Personzentrierte Systemtheorie zu konzipieren?
Als ich Anfang der 1980er mein Lehrbuch „Grundkonzepte der Psychotherapie“ schrieb – das heute in 7. Auflage vorliegt – habe ich ein Kapitel jeweils nur dann abgeschlossen, wenn ich so viel von einem Ansatz gelesen hatte, dass ich davon überzeugt war. Am Ende standen dann dort weit mehr als ein Dutzend Ansätze in den vier Grundorientierungen psychodynamisch, verhaltenstherapeutisch, humanistisch und systemisch. Von jedem Ansatz war ich überzeugt, dass er seine Berechtigung hat und wirkt – aber damit stellte sich die Frage: wie passt das alles zusammen?
Auf der Suche nach einer befriedigenden Antwort habe ich vieles Interessante gefunden. Aber irgendwie schien mir immer irgendetwas überbetont und anderes ausgeblendet zu sein. Ich selbst hatte zunächst eine Ausbildung in Personzentrierter Psychotherapie bzw. „Gesprächspsychotherapie“ absolviert und war durch einen klugen Mitarbeiter – und heutigen Freund und Kollegen –, Arist von Schlippe, mit dem damals noch neuen systemischen Ansatz in Kontakt gekommen. Das waren zwei Schwerpunkte – aber auch hier fehlte mir bald etwas: nämlich beim personzentrierten Ansatz die strukturelle Perspektive der Systemiker, die Systemiker hingegen waren auf Interaktionen fokussiert und blendeten die persönlichen Sinndeutungen und deren affektive Basis aus. Berücksichtigt man beides – und ignoriert auch einige weitere Erkenntnisse etwa aus der Säuglingsforschung oder der Evolutionspsychologie nicht beharrlich – so kommt man schnell zu einer Konzeption, die dann irgendwann „Personzentrierte Systemtheorie“ genannt wurde.
Es stand somit immer mein Wunsch im Zentrum, meine Klienten, Mitmenschen und mich selbst hinlänglich zu verstehen und dabei möglichst wenige zentrale Erkenntnisse auszublenden, welche die vier therapeutischen Grundorientierungen und die Psychologie auszeichneten. Meinen Ansatz nenne ich daher auch nicht integrativ – denn da kommt nicht Unterschiedliches zusammen. Sondern es ist genau andersherum: Ich versuche von dem, was in jedem Augenblick zusammenwirkt, möglichst wenig systematisch auszublenden.
Was bedeuten die 4 Systemebenen der PZS? Wo und wie spielen die in der Praxis eine Rolle?
Nehmen wir eine alltägliche Situation – etwa unser Gespräch jetzt. Wie kann ich meine Gedanken, Gefühle und mein Handeln verstehen, und wie das Ihre und unsere Interaktion?
Nun zunächst würde ich vielleicht – typisch personzentriert – darauf schauen, mit welchen Erwartungen und Vorstellungen ich in unser Gespräch gegangen bin, ob ich den Eindruck habe, dass wir uns tatsächlich unterhalten können (trotz der Einseitigkeiten eines Interviews) oder nur eine „Show“ abgezogen werden soll. Mir geht also durch den Kopf: was will mein Gegenüber – und dann die LeserInnen – wirklich wissen, was ist relevant, und wie kann ich das vermitteln. All diese Aspekte haben mit dem zu tun, was man „psychische Prozesse“ nennt. Und ich komme gar nicht umhin, mir auch mehr oder weniger Gedanken um Ihre psychischen Prozesse zu machen.
Genauso kann ich aber – typisch Systemiker – auf die Interaktionsstrukturen blicken. Läuft unser „turn-taking“, d.h. der Gesprächswechsel, reibungslos? Wird dies der Struktur eines Interviews gerecht? Haben sich vielleicht schon nach kurzer Zeit bestimmte Regeln in unserem Miteinander eingeschlichen – die es sicher geben würde, wenn wir länger und öfter zusammen wären. Erinnert mich unsere Interaktion an typische Situationen und Strukturen in meiner Familien, oder meiner Freundes- oder Kollegengruppe? Nehme ich bei Ihnen (unterstellt) so etwas wahr? All diese Aspekte haben mit dem zu tun, was man „interpersonelle Prozesse“ nennt. Dazu gehört nicht nur das, was gerade kommunikativ zwischen uns abläuft, sondern auch die Erfahrungsstrukturen beispielsweise aus meiner und Ihrer Herkunftsfamilie sowie aus anderen Kleingruppen.
Fraglos finden nun nicht entweder psychische oder interpersonelle Prozesse statt, sondern in jedem Augenblick beide. Und sie beeinflussen sich zudem gegenseitig. Denn unsere Interaktionsstruktur ist mit davon beeinflusst, wie ich mich fühle und welche Gedanken mir kommen und dies ist, andersherum, mit davon abhängig, wie unsere Interaktion so „läuft“.
Die bisher skizzierten Prozessebenen, die psychische und die interpersonelle, sowie deren gegenseitige Beeinflussung ist etwas, worauf jeder gute Therapeut, Berater und Coach heute schaut. Da sage ich also zunächst wenig Neues.
Aber die interpersonellen Strukturen – besonders die inneren und realisierten Bilder von Beziehung, Echtheit, Dominanz, Begegnung, familiären Erwartungen etc. – und auch viele der Gedanken kommen ja nicht einfach aus uns heraus oder werden in diesem Augenblick und in dieser Konstellation völlig neu von uns erfunden. Vielmehr sind wir beide eingebettet in unsere Kultur – wenn auch in mehr oder weniger unterschiedliche Teilbereiche davon. Diese stellt nicht nur die Worte und Begriffe, mit denen wir uns unterhalten zur Verfügung. Sondern mit der Sprache sind auch Metaphern, Verstehens- und Erklärungsprinzipien, Vorstellungen über Gut und Böse, richtig und falsch, krank und gesund usw. verbunden. Kurz: In jedem Augenblick sind auch die Einflüsse dieser kulturellen Verstehens- und Deutungsprozesse vorhanden.
Und letztlich wirken in jedem Augenblick auch Einflüsse aus meinem und Ihrem Körper mit ein: Dies beginnt schon bei den Affekten – die ja unsere Gedanken und unsere Interaktion nicht unbeträchtlich beeinflussen. Aber auch vieles, was wir in den modernen Diskursen als Verkörperungen unserer Biographie bezeichnen. Etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, unsere verkörperten frühen Erfahrungen über die Sicherheit von Beziehungen in Form von Bindungsstrukturen.
Nun habe ich noch gar nicht spezielle Fragen und Perspektiven aufgeworfen, die beispielsweise dann bedeutsam werden, wenn ich z.B. mit einem zerstrittenen Team eines Unternehmens arbeite. Es wird also oft noch weitere Prozesse und Prozessebenen geben, die beachtenswert sind.
Was man aber sagen kann, ist, dass zumindest die vier genannten Prozessebenen – die psychische und die interpersonelle und deren Einbettung in kulturelle und körperliche Prozesse – berücksichtigt werden müssen, wenn man nicht systematisch etwas Relevantes ausblenden will. „Berücksichtigen“ heißt nicht, dass man alles in jedem Augenblick „auf dem Schirm“ haben muss – das wäre eine Überforderung. Aber es muss klar sein, dass in jedem Augenblick Prozesse auf mindestens diesen vier Ebenen das Geschehen beeinflussen, auch wenn ich mich kurzfristig auf weniger fokussiere. Aber langfristig und/oder systematisch eine oder mehr Prozessebenen auszublenden wäre sicher ein Fehler. Für mich ist das so selbstverständlich, dass ich mich wundere, wie viele Ansätze ohne diese vier Ebenen auskommen.
Nun ist die Aufzählung und Beschreibung von relevanten Prozesseben zwar wichtig, aber natürlich noch keine Theorie. Ohne jetzt zu lang zu werden, sei zumindest darauf verwiesen, dass die Personzentrierte Systemtheorie hier bei einer interdisziplinären, strukturwissenschaftlichen Konzeption unter dem Begriff „Synergetik“ quasi andockt. Daher gibt es recht präzise Vorstellungen darüber, wie sich die Prozesse auf diesen Ebenen zu solchen Mustern stabilisieren, die wir „Probleme“ oder „Symptome“ nennen, und wie diese verändert werden können. Das macht den Kern der Personzentrierten Systemtheorie aus.
Warum ist das Subjekt so wichtig? Was bedeutet das konkret? Und wie ist das mit dem Begriff der Lebenswelt verbunden?
Systemiker reden ja von Systemen – und dazu gehört natürlich auch zu klären, was jeweils nicht zum System gehört. Das nennen sie „System-Umgebung“. Und natürlich hat eine spezifische Umgebung bzw. deren Veränderung Einfluss auf das System. Nehmen wir eine Familie oder ein Team als System. Dann gehört beispielsweise die Schule der Kinder oder die ganze Abteilung zur Umgebung. So weit scheint alles ganz klar und einfach zu sein.
Denken wir nun aber einmal etwas genauer darüber nach, welchen Einfluss die Umgebung auf die Dynamik des Systems hat. So merken wir, dass plötzlich die Frage auftaucht: Meinen wir jene Umgebung, welche Beobachter, Wissenschaftler oder Berater beschreiben? Oder meinen wir jene Umgebung, wie sie die beteiligten Subjekte selbst beschreiben? Meinen wir also die „Schule“, wie sie „im Buche“ steht, oder wie sie die Sozialarbeiter beschreiben. Oder meinen wir mit „Schule“ das, was die Kinder und die Eltern – und sicher jeder nochmals unterschiedlich – wahrnehmen und darunter verstehen?
 Ich denke, dass wir allzu sehr die Perspektive der konsensuell erzeugten, abstrakten akademischen Realität, die wir „objektiv“ nennen, beachten und dagegen die Perspektive der Menschen als Subjekte vernachlässigen wenn nicht ganz ausblenden. Dies wird an dem Begriffspaar „Befunde“ und „Befindlichkeiten“ deutlich: Befunde sind die „objektiven“ Daten medizinischer oder therapeutischer Diagnostik – oft genug mit Apparaten und Tests erbracht. Diese sind keineswegs identisch mit den Befindlichkeiten der Subjekte. Nicht selten laufen beide Perspektiven sogar auseinander: Dann gibt es gute Befunde aber schlechte Befindlichkeiten oder umgekehrt. Es ist also klar, dass das eine nicht einfach das andere ersetzen kann sondern beides wichtig ist: Schlechte Befunde können auch bei guter Befindlichkeit darauf hinweisen, dass hier möglicherweise eine Entwicklung stattfindet, die bald auch die Befindlichkeiten verschlechtert, wenn man nicht reagiert. Umgekehrt kann es aber auch nicht befriedigen, wenn die Befunde zwar gut sind, die Befindlichkeiten aber miserabel.
Ich denke, dass wir allzu sehr die Perspektive der konsensuell erzeugten, abstrakten akademischen Realität, die wir „objektiv“ nennen, beachten und dagegen die Perspektive der Menschen als Subjekte vernachlässigen wenn nicht ganz ausblenden. Dies wird an dem Begriffspaar „Befunde“ und „Befindlichkeiten“ deutlich: Befunde sind die „objektiven“ Daten medizinischer oder therapeutischer Diagnostik – oft genug mit Apparaten und Tests erbracht. Diese sind keineswegs identisch mit den Befindlichkeiten der Subjekte. Nicht selten laufen beide Perspektiven sogar auseinander: Dann gibt es gute Befunde aber schlechte Befindlichkeiten oder umgekehrt. Es ist also klar, dass das eine nicht einfach das andere ersetzen kann sondern beides wichtig ist: Schlechte Befunde können auch bei guter Befindlichkeit darauf hinweisen, dass hier möglicherweise eine Entwicklung stattfindet, die bald auch die Befindlichkeiten verschlechtert, wenn man nicht reagiert. Umgekehrt kann es aber auch nicht befriedigen, wenn die Befunde zwar gut sind, die Befindlichkeiten aber miserabel.
Ich betone daher die Komplementarität beider Perspektiven: Beide gehören zusammen und sind wichtig. Mir scheint aber, dass wir einseitig die „objektive“ Perspektive der Befunde fokussieren und die Perspektive der Subjekte zu wenig berücksichtigen. Das wird auch an Begriffspaaren wie Bedarf und Bedürftigkeit deutlich. Oder an Begriffen wie „Ressourcen“: Oft meinen wir damit einseitig jene Ressourcen, die wir als Berater, oder die ein „objektiver“ Beobachter, beschreiben würde. Für die beteiligten Menschen aber können ganz andere Dinge und Aspekte eine Ressource sein, und manches von dem „objektiv“ Beschriebenen ist recht irrelevant.
Wenn man sich auf diese Komplementarität einlässt, wird deutlich, dass es einen Unterschied macht, ob wir von der „objektiven“ Umgebung eines Systems reden – so wie neutrale Beobachter sie beschreiben würden – oder eben von dem, wie die beteiligten Subjekte das sehen und empfinden und was für sie wichtig ist. Bei letzterem spricht man nicht von „Umgebung“ sondern es gibt eine lange Tradition, dies als „Lebenswelt“ zu bezeichnen.
Sie betonen, alle Kommunikation müsse durch das Nadelöhr persönlicher Sinndeutungen gehen. Warum ist es Ihnen so wichtig, das so deutlich hervorzuheben?
In der Geschichte der Familientherapie und der systemischen Ansätze gab es eine Zeit – der Höhepunkt war in den 1990er Jahren – wo fast ausschließlich auf die Interaktionsstrukturen geschaut wurde. Wenn aber A zu B etwas sagt und B darauf antwortet, so spielt eben nicht nur die Interaktionsstruktur eine Rolle, wie ich vorhin sagte. Sondern es hängt auch davon ab, was B gehört und verstanden hat. Denn Sinn und Bedeutung findet immer nur auf der Ebene der Personen statt – auch wenn man sich auf eine gemeinsame Sichtweise einigen kann oder im Verhalten Regeln etabliert, denen man unterworfen ist, obwohl man sie nicht einmal durchschaut. Und es ist, wie ich sagte, wichtig, auch zu berücksichtigen, dass bei der Art und Weise, wie die Kommunikation durch die Nadelöhre geht, die affektiven Befindlichkeiten, die Bedürfnisse, die biographischen Erfahrungen und die spezifischen subkulturellen Verstehensweisen, Erklärungsprinzipien, Geschichten usw. eine Rolle spielen. Womit wir wieder bei den vier Prozessebenen wären.
Ich habe das kürzlich intensiv mit Fritz Simon diskutiert, der ja vielen als Vertreter einer auf Luhmann zurückgehenden soziologischen Kommunikationstheorie – der Autopoiese – bekannt ist. Diese Diskussion fand unter Moderation von Matthias Ohler statt, und das Ganze wurde 2019 als Buch im Carl-Auer-Verlag publiziert.
Was bedeuten konkret Begriffe/Konzepte wie Nicht-linearität, (Sinn- und Interaktions-)Attraktoren, Synlogisation, Komplettierungsdynamik?
Unser Denken wird immer noch von einfachen Ursache-Wirkungs-Modellen beherrscht. Möglicherweise sogar als evolutionäres Erbe – denn wenn ich bei einem vierstöckigen Haus unten klingle und oben springt ein Fenster auf und ein Blumentopf fällt herunter, ist mein unmittelbares Erleben: „Oh je, das habe ich verursacht!“. Erst danach setzt mein Denken ein: „Quatsch, da gibt es gar keinen kausalen Zusammenhang“. Auch unsere Analyseinstrumente der akademischen Psychologie sind von solchen linearen Kausalmodellen durchzogen.
Dagegen steht aber die Erfahrung, dass bei komplexeren Prozessen eher Nichtlinearitäten typisch sind. Wenn ich 3-stellige Zahlen addiere und ich schaffe in 30 Minuten 600 Additionen, so macht es Sinn davon auszugehen, dass ich nach 15 Minuten etwa 300 – also die Hälfte – oder nach 10 Minuten etwa 200 – also ein Drittel – geschafft habe. Wenn ich aber über ein schwieriges Problem nachdenke und ich schnippe nach 30 Minuten mit den Finger und sage: „Aha! Ich hab´s!“ so ist es recht unsinnig anzunehmen, dass ich nach 15 Minuten dieses Problem halb oder nach 10 Minuten zu einem Drittel gelöst hatte. Ein Kind, das mit 14 Monaten anfängt zu laufen und dies dann innerhalb weniger Tage recht sicher beherrscht, konnte nicht nach 7 Monaten „halb laufen“. Und ein Beratungsprozess, der nach 5 Sitzungen als „erfolgreich“ eingestuft wird, war nicht nach 1 Stunde 20% erfolgreich.
Die meisten Prozesse im Bereich des Lebendigen laufen also nichtlinear ab und sie sind, wie ich schon bei den Prozessebenen betonte, miteinander vernetzt. Das wiederum bedeutet, dass statt Input-Output-Beziehungen Rückkopplungen typisch sind. Schon unser Gehirn oder unser Organismus ist als ein komplexes, rückgekoppeltes System zu verstehen. Ebenso Teams oder Familien, wo das, was jemand tut und sagt, nicht nur auf andere wirkt, sondern dies irgendwie über viele weitere Schritte auf ihn zurückwirkt.
Für solche nichtlinearen dynamischen Systeme ist nun wiederum typisch – wie die interdisziplinäre Systemforschung an tausenden Beispielen und Untersuchungen belegen kann –, dass selbstorganisiert Ordnungen entstehen. Diese nennt man allgemein „Attraktoren“. In unserem Bereich der Beratung geht es nun aber nicht um die Essentials der Naturwissenschaften, Materie und Energie, sondern um Sinn und Bedeutung. Daher spreche ich von Sinn-Attraktoren. Man kann zeigen und experimentell untersuchen, dass Prozesse, in denen Information rückgekoppelt wird, ebenfalls Ordnungen generieren. So entstehen beispielsweise im Gespräch zweier Menschen aus tausenden Worten und Themen schnell wenige Bedeutungskerne, die es uns ermöglichen, die letzten tausend Worte unseres Gegenüber zu einigen wenigen Aussagen zusammenzufassen. Diese allerdings beeinflussen in einer Rückkopplung das, worauf im weiteren Gespräch geachtet und wie es verstanden wird.
Diese gemeinsame Abstimmung der Themen und Bedeutungen habe ich „Synlogisation“ genannt – das ist analog zu „Synchronisation“, aber es geht ja nicht um Zeit, d.h. „Chronos“, sondern um Bedeutung d.h. „Logos“.
Und mit „Komplettierungsdynamik“ ist letztlich das Phänomen gemeint, dass eine sich bereits abzeichnende Ordnung im weiteren Verlauf komplettiert wird. Bei einem alten Ehepaar auf der Couch reichen wenige Worte und der Partner meint schon zu wissen, wie es weitergeht – ohne überhaupt noch zuzuhören. In seinem „inneren Film“ komplettiert er automatisch eine ganze Szene. Wenn, um ein anderes Beispiel zu nennen, nach einem Konzert aus dem Rauschen des Beifalls ein rhythmischen Klatschen von nur 10 oder 20 Leuten wahrnehmbar ist, komplettiert schnell der ganze Saal mit tausend oder mehr Menschen diesen Rhythmus. Auch dieses Phänomen ist interdisziplinär gut untersucht und genau beschreibbar.
Ist das nicht teilweise eine recht „technische“ Begrifflichkeit?
Ich finde die genannten Beispiele eigentlich sehr anschaulich und nicht untypisch für den menschlichen bzw. beraterischen Alltag. Und in dem 2017 erschienenen umfassenden Werk dazu – Subjekt und Lebenswelt – habe ich viele weitere Beispiele an- und im Detail ausgeführt. Aber es ist schon richtig: Begriffe wie „Attraktor“ usw. sind für viele noch gewöhnungsbedürftig, selbst wenn sie in der systemischen Szene zuhause sind.
Aber es geht eben nicht primär um die Begriffe selbst, sondern dass damit sehr präzise Vorstellungen verbunden sind, die interdisziplinär im Rahmen der Synergetik entwickelt wurden und auf welche die Personzentrierte Systemtheorie zurückgreift.
Da die Synergetik von Hermann Haken zunächst in der Physik und dann allgemeiner in den Naturwissenschaften entwickelt wurde, haben früher einige Kritiker angeführt, dass es sich um eine naturwissenschaftliche Theorie handle, die für beraterisches Geschehen inadäquat sei. Aber dieses Argument ist falsch. Denn die Synergetik ist eine strukturwissenschaftliche Theorie, die eben zuerst und auch auf Phänomene in den Naturwissenschaften angewendet wurde. Aber das ist 50 Jahre her. Inzwischen hat dieser Ansatz längst Einzug in Disziplinen wie Psychologie, Pädagogik, Soziologie usw. gehalten. Und ich glaube, dieses Missverständnis ist inzwischen weitgehend geklärt und die Kritik damit auch weitgehend verstummt.
Gibt es vergleichbare Ansätze, und wie grenzen Sie Ihr Modell davon ab?
In dem Anliegen – einen eher schulenübergreifenden Ansatz zu formulieren, der zudem weitere Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung nutzt – sehe ich Ähnlichkeiten mit dem Ansatz einer „allgemeinen Psychotherapie“ von Klaus Grawe. Das geht sogar über das reine Anliegen hinaus, weil es auch strukturelle Ähnlichkeiten gibt, die hier jetzt zu weit führen würden. Der große Unterschied ist allerdings, dass Grawe eine eigene Therapierichtung kreieren wollte, während ich mich hier völlig zurückhalte und eher ein Erklärungswerk liefern möchte, an das dann Therapeuten, Berater und Coaches mit ihren Ansätzen andocken und diese erweitern können. In den letzten hundert Jahren sind so viele kluge Vorgehensweisen entwickelt worden, da muss ich nicht einen weiteren offiziellen Therapieansatz erfinden. Mir geht es eher darum zu beschreiben und zu erklären, wie die unterschiedlichen Ansätze zusammenpassen. Es zeigt sich allerdings, dass dies eine gute Basis ist, um kreativ passende Vorgehensweisen zu gestalten, weil man nicht einen übervollen Kasten mit vorgefertigtem und verfahrensspezifischem Werkzeug im Kopf haben muss, sondern allgemeine Prinzipien situationsgerecht entfalten kann.
Warum haben Sie das Bundesverdienstkreuz erhalten?
Soweit ich weiß, steht grundsätzlich in der Urkunde des Bundespräsidenten nie explizit, wofür das verliehen wurde. Aber man kann natürlich einerseits nachsehen, wer die Verleihung angeregt hat, und was dann bei der Übergabe durch ein Staatsorgan aus den umfangreichen Unterlagen der Staatskanzlei in die Laudatio einfließt.
Bei mir war dies so, dass die Anregung von der AGHPT – der Arbeitsgemeinschaft Humanistische Psychotherapie – ausging. In der AGHPT sind zehn Verbänden der Humanistischen Psychotherapie mit insgesamt rund 10.000 Mitgliedern vertreten, zu deren Zusammenschluss vor zehn Jahren ich wesentlich beigetragen und auch den Antrag auf die „wissenschaftliche Anerkennung“ an den „Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie“ federführend übernommen hatte. Darüber hinaus setze ich mich seit mindestens dreißig Jahren dafür ein, dass die Humanistische Psychotherapie auch in Deutschland einen angemessenen Platz im Spektrum von psychodynamischen, behavioralen und systemischen Verfahren bekommt. Wir sind ja leider das einzige Land der Welt, wo Patienten dieser Ansatz – mit dem viele tausend Patienten und Patientinnen bis 1999, vor dem Psychotherapeutengesetz, sehr erfolgreich behandelt wurden – vorenthalten wird und eine Psychotherapieausbildung wie bei den anderen Verfahren nicht mehr möglich ist. Das betrifft allerdings gottlob nicht den Beratungs- und den Coachingbereich, wo nach wie vor viele dieser humanistische Konzepte zu finden sind.
Wenn man es also kurz sagen will, habe ich diese Auszeichnung für meinen Einsatz für die Humanistische Psychotherapie erhalten. Und ich freue mich, dass damit indirekt auch viele weitere Menschen, die sich seit langer Zeit für die Humanistische Psychotherapie in Deutschland eingesetzt haben, gewürdigt wurden.
Wie schätzen Sie die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Studienfach „Psychotherapie“ ein?
Da ist noch vieles im Umbruch. Die wichtigste Verbesserung liegt vielleicht darin, dass die unhaltbare Situation einer oft unbezahlten Arbeit in Kliniken während der Ausbildung nun beendet ist. Wie weit die Universitäten ihre Zusage allerdings realisieren, eine verhaltenstherapeutische Monokultur im Studium durch eine wissenschaftlich angemessene Pluralität in den vier Grundorientierungen zu ersetzen, muss sich noch zeigen. Immerhin sind ja fast alle klinischen Professuren in der Psychologie mit Verhaltenstherapeuten besetzt – was nicht einmal der Verhaltenstherapie geschweige denn der Psychotherapie oder den Patienten in Deutschland insgesamt gut tut. Ebenso muss man sehen, wie und wie weit im Studium und danach wirklich eine qualifizierte Praxis möglich ist. Therapie lernt man nicht primär aus Lehrbüchern – ebenso wenig wie Beratung und Coaching –, so wichtig auch theoretische und grundlegende Kenntnisse sind.
Ich bin gottlob alt genug, dass ich mir diese umfassende und sicher länger dauernde Entwicklung ein wenig aus dem Lehnstuhl ansehen und mich auf Dinge konzentrieren darf, wo ich vielleicht noch etwas bewirken kann. Und da freue ich mich sehr, wenn mir Menschen rückmelden, dass die Personzentrierten Systemtheorie ihre Sicht bereichert und das Verständnis für das komplexe Geschehen im therapeutischen und beraterischen Raum vertieft hat – und dass sie auch konkret etwas damit anfangen können.
Vielen Dank für das Interview!
- Hier finden Sie eine Rezension des Buches Subjekt und Lebenswelt.
- Leseprobe: “Der Körper als Integrator von Fühlen und Denken”
Literaturhinweise:
- Jürgen Kriz (2017). Subjekt und Lebenswelt – Personzentrierte Systemtheorie für Psychotherapie, Beratung und Coaching. Vandenhoeck & Ruprecht. Hier finden Sie das Buch auf der Seite des Verlags.
- Matthias Ohler (Hrsg.), Jürgen Kriz & Fritz B. Simon (2019). Der Streit ums Nadelöhr. Carl-Auer Verlag. Hier finden Sie das Buch auf der Seite des Verlags.
- Jürgen Kriz (2014). Grundkonzepte der Psychotherapie. Weinheim: Beltz/PVU, 7. überarbeitete und erweiterte Auflage. Hier finden Sie das Buch auf der Seite des Verlags.
- Jürgen Kriz (2011): Chaos, Angst und Ordnung. Wie wir unsere Lebenswelt gestalten. Göttingen/Zürich: Vandenheock & Ruprecht, 3. Auflage. Hier finden Sie das Buch auf der Seite des Verlags.
- Jürgen Kriz (2019) Personzentrierte Systemtheorie und ihre praktische Bedeutung im Coaching, Coaching-Magazin, 1, 2019, www.coaching-magazin.de/prozesse-settings/personzentrierte-systemtheorie.