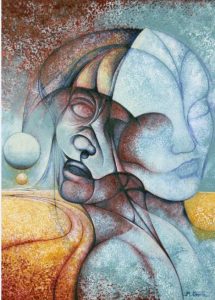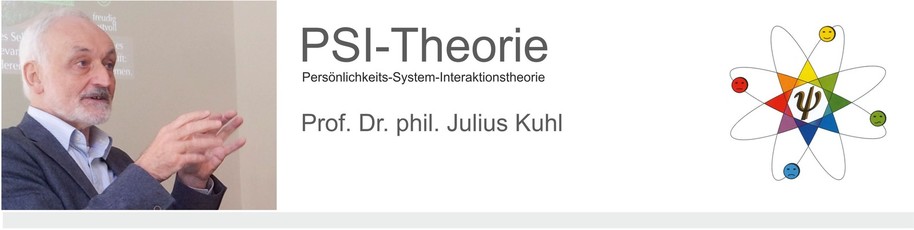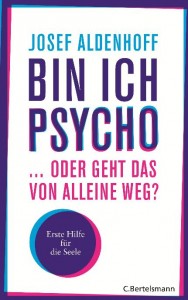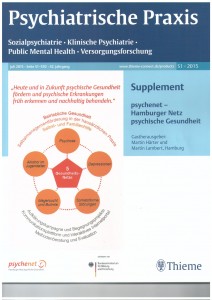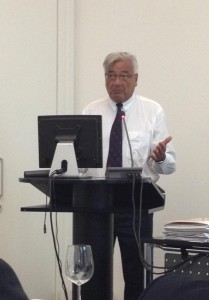Im ersten Teil dieses Artikels Das verlorene Selbst wurde ein Problem beschrieben, das aus einem verminderten Selbstwertgefühl resultieren kann, und unter Zuhilfenahme der PSI-Theorie nach einer Idee gesucht, wie es sich lösen lassen könnte. Zentral erscheint mir hierbei der Begriff des „freien Selbstseins“. Doch wie kann es (kurz gesagt) gelingen, sich die Freiheit zu gestatten, die eigenen Motive anzunehmen, wenn sich das Selbst beharrlich verweigert, sich bzw. die eigenen Bedürfnisse ernst- bzw. überhaupt nur wahrzunehmen?
Sicher ist es hilfreich, sich jener Introjekte, die einem schaden bzw. die dysfunktional sind, bewusst zu werden. Dafür gibt es zahlreiche Methoden, wie bspw. die Selbstverbalisierung, das „Tagebuch negativer Gedanken“ etc. Dennoch erreicht man mit derlei (kognitiv ausgerichteten) Methoden wohl vor allem das explizite Selbstwertgefühl, während sich das implizite davon in vielen Fällen recht wenig beeindrucken lässt. Auch mit Interventionen, die Emotionen fokussieren und einen Dialog zwischen verschiedenen inneren Anteilen initiieren (wie z. B. die Stuhltechnik), kommt man m. E. nicht immer weiter.
Entscheidend für das Selbst scheint es zu sein, in zwischenmenschlichen Beziehungen gespiegelt zu bekommen, dass es liebenswert ist und es deshalb wunderbar ist, gut zu sich zu sein. Das geht prinzipiell auch außerhalb einer Therapie oder eines Coachings, wenn man das Glück hat, einem Menschen zu begegnen, der oder die einem eine positive Beziehungserfahrung ermöglicht. So wird das Selbst gestärkt und es kann sich allmählich von seinen dysfunktionalen Selbstbe- oder -abwertungen lösen. Kurzum: “Love is the key,“ Aber auch die Liebe müsste man zunächst zulassen können, ohne sich vor ihr „wegzuducken“…
Prof. Dr. Julius Kuhl stellte zum Schluss des Artikels Folgendes fest: „Der Vergleich zwischen explizitem und implizitem Freiheitsmotiv ermöglicht Diskrepanzen zu beurteilen zwischen dem Ausmaß an persönlicher Freiheit, das jemand bewusst anstrebt und zulässt, und dem Ausmaß, in dem er „freies Selbstsein“ unbewusst ersehnt. So gibt es z. B. Menschen, die ihr Bedürfnis nach freiem Selbtsein auf bewusster Ebene als niedrig beurteilen, obwohl sie in ihrer spontanen (gar nicht immer bewusst erfahrbaren) Fantasie […] ein starkes Bedürfnis nach freiem Selbstsein haben. Eine solche Diskrepanz kann die Selbstabwertung und den inneren Stress enorm erhöhen und chronifizieren, ohne dass die eigentliche Quelle dieses inneren Stressors bewusst werden muss.“
Da mir klar ist, dass es wahrscheinlich keine „Patentlösung“ geben wird, habe ich die Frage, wie diese Diskrepanz verringert oder sogar aufgelöst werden kann, mit Dr. Bernd Schmid, Günter G. Bamberger und Cornelia Klioba diskutiert.
Lösungsansätze im Coaching
Coaching ist keine Psychotherapie. Obwohl es auch der Selbstreflexion und -findung dient, hat es nicht zum Ziel, psychische Erkrankungen zu heilen. Der Schweregrad bzw. die Ausprägung einer Problematik und ihre Auswirkungen auf das gegenwärtige Geschehen (z. B. in Form von Konflikten) sowie auf das Erleben (bspw. ob es einen „Leidensdruck“ gibt) sind Indikatoren dafür, welche Form der Unterstützung in einem speziellen Einzelfall angeraten ist.
An der Herangehensweise von Dr. Bernd Schmid gefällt mir die Konzentration auf die gegenwärtigen (bspw. für ein Arbeitsteam relevanten) Prozesse und Beziehungsmuster. Mit dieser Strategie habe ich bislang gute Erfahrungen gemacht, wenn man ggf. etwas in die Tiefe geht. Da bei einem entsprechenden Problem zu erwarten ist, dass eine Entwicklungsaufgabe irgendwie nicht glücklich oder eine Ergänzungsaufgabe noch nicht gelöst wurde, müsste man hier wohl etwas genauer hinschauen. Ob dies ggf. im Rahmen eines Coachings oder eher in einer Psychotherapie geschehen sollte, lässt sich nur im Einzelfall beurteilen. Den Schlussbemerkungen entnehme ich aber die Sorge, dass man das Problem eventuell verschärft, wenn man sich zu sehr auf die Vergangenheit (bzw. auf die Ursachen) fixiert. Neufindung klingt da schon ganz anders…
Hier finden Sie die Antwort von Dr. Bernd Schmid.
Beschäftigt man sich regelmäßig mit der Frage, wie die eigene Vergangenheit dazu führen konnte, dass man heute so ist, wie man sich sieht, so findet man im Laufe der Zeit sicher ganz unterschiedliche Antworten darauf. Wirklichkeitskonstruktionen sowie die auf ihnen basierenden Einstellungen und Verhaltensmuster folgen eigentlich immer irgendeiner Logik, die in einem bestimmten Bezugsrahmen sinnvoll ist oder war. Ändert sich allerdings der Kontext, was im Laufe eines Lebens gelegentlich geschieht, werden sie manchmal dysfunktional. Dann lohnt es sich, die entsprechenden Gegebenheiten mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten bzw. die eigene Sichtweise zu erweitern, um zu einer spezifischeren bzw. angemesseneren Haltung zu finden. In diesem Zusammenhang bringt Günter G. Bamberger („Lösungsorientierte Beratung“) den Begriff der „Ambiguitätstoleranz“ ins Spiel.
Hier finden Sie die Antwort von Günter G. Bamberger.
Zurück zur PSI-Theorie: Eine Leserin des Artikels „Das verlorene Selbst“, die mit dem Modell von Prof. Dr. Julius Kuhl bestens vertraut ist, machte mich darauf aufmerksam, dass es beim Selbstwachstum darauf ankomme, „auch und gerade die negativen Gefühle an sich heranzulassen, um sie nachhaltig in das Selbst zu integrieren“. Das macht bei der zuvor beschriebenen Problematik m. E. allerdings nur dann Sinn, wenn zunächst auch positive Erfahrungen (also z. B. „dass man sich etwas gönnen bzw. gut zu sich sein darf“) entsprechend gespiegelt wurden, damit die eigenen Motive später überhaupt wahr- und angenommen werden können. Ansonsten gestaltet sich (zumindest meiner Erfahrung zufolge) auch die Arbeit mit Methoden, die der Aktivierung von Ressourcen oder der Formulierung von handlungswirksamen Zielen dienen (wie bspw. das von ihr erwähnte Züricher Ressourcen Modell®), eher schwierig. Den uneingeschränkten Optimismus, mit dem derlei Methoden vermarktet und praktiziert werden, so wirkungsvoll sie im Grunde genommen auch sein mögen, teile ich jedenfalls bei einer so speziellen Problematik nicht. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass sie grundsätzlich dazu beitragen können, die Lebenszufriedenheit eines Menschen (deutlich) zu erhöhen.
Hier finden Sie die Antwort von Cornelia Klioba.
Über die Autoren:
- Dr. Bernd Schmid ist Leitfigur des isb-Wiesloch www.isb-w.eu, der Schmid-Stiftung http://schmid-stiftung.org/ und des International Network for Organization Development and Coaching www.inoc-network.org. Essays unter www.blog.bernd-schmid.com. Er ist u.a. Ehrenvorsitzender Präsidium DBVC, Ehrenmitglied der Systemischen Gesellschaft, Preisträger des EATA-Wissenschaftspreises 1986 und des Eric Berne Memorial Award 2007 der Internationalen TA-Gesellschaft, Life Achievement Award 2014 der deutschen Weiterbildungsbranche.
- Günter G. Bamberger ist Diplom-Psychologe, Coach und Autor des Buches „Lösungsorientierte Beratung“, das m. E. zu den besten seiner Art zählt. Weitere Informationen über ihn und seine Arbeit finden Sie auf der Webseite www.coachwalk.de.
- Cornelia Klioba ist als Begabungspsychologische Beraterin und Referentin im Bereich der Begabtenförderung tätig. Einzelfallbegleitung und Workshops für Eltern bietet sie ebenso an wie Fortbildungen und Vorträge in Kindergärten und Schulen. Im Einzel-Coaching setzt sie unter anderem die TOP-Diagnostik ein.