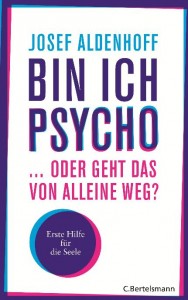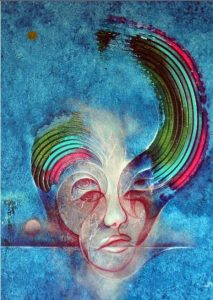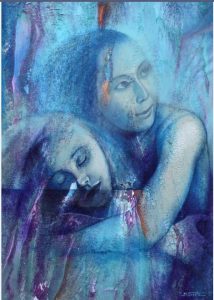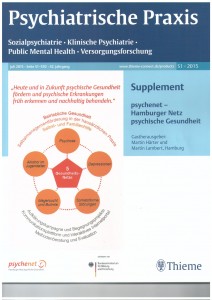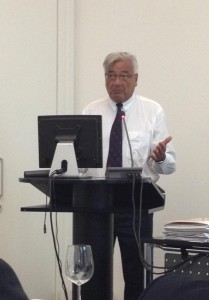Im März hatte ich die Gelegenheit, Dr. Bernd Schmid in Wiesloch zu besuchen und mit ihm über seine Arbeit zu sprechen. Da ich mich auf dieses Gespräch allerdings nicht richtig vorbereiten konnte, habe ich ihn darum gebeten, mir im Nachklang – also im Rahmen eines Interviews – ein paar Fragen zu beantworten. Sollte es Sie also auch interessieren, was sich hinter der „Systemischen Transaktionsanalyse“ verbirgt, welche Erfahrungen ihr Begründer mit den verschiedenen Verfahren oder Lehren machen durfte, die im Coaching sowie im psychotherapeutischen Kontext einen gewissen Ruhm erlangt haben, oder was ihn überhaupt dazu angetrieben hat, sich mit derartigen Fragestellungen zu befassen, dann finden Sie hier einige Antworten!
Wer ist Dr. Bernd Schmid?
Wer ich bin? Eine gelungene Promenadenmischung vielleicht?! Irgendwie bin ich jedenfalls ein bunter Hund, der nirgends richtig hineingepasst hat und deswegen immer seinen eigenen Weg suchen musste. Die Evolutionsleute nennen solche Kreaturen – wenn ich mir schmeichle – „hopefull monsters“. Sie sehen aus wie Missgeburten, sind aber vielleicht der Anfang einer neuen Spezies. Die Evolution macht viele Experimente und das Schicksal eines Einzelnen interessiert nicht, so dass viele Unangepasste Schiffbruch erleiden und untergehen. Irgendwie haben mich aber glückliche Umstände, einige Talente und Ambitionen sowie viel Fleiß davor bewahrt. Zudem hatte ich immer ein Gespür dafür, wohin sich meine Umwelt entwickeln wird, und lag damit eigentlich nie wirklich falsch. Im Laufe der Zeit konnte ich das immer besser formulieren und entsprechend agieren.
So habe ich auf meinem beruflichen Werdegang viele Bereiche kennengelernt, wollte mich jederzeit frei dorthin bewegen, wo ich es wirklich interessant fand, habe immer neue Aufbrüche gewagt, wenn Möglichkeiten zu Vorschriften, wenn Lehren zu Dogmen verkamen. Daneben bin ich wohl als Entwickler und Unternehmer begabt, so dass aus Ideen, die viele haben, eine Schatzkiste stimmiger Konzepte und Vorgehensweisen geworden ist und ein erfolgreiches Unternehmen. Die isb-Konzepte gehören mittlerweile in vielen Feldern zum Hand- und Denk-Werkzeug von Professionellen.
Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, sich beruflich vorrangig mit psychologischen Themen zu befassen und im therapeutischen Bereich tätig zu werden?
Der Psychologie Jung’scher Prägung bin ich zunächst in meiner Schwiegerfamilie begegnet, der Pädagogischen Psychologie und der Sozialpsychologie im Studium. Die Gruppendynamik und die humanistischen Verfahren habe ich mir dann selbst gesucht. Psychotherapie faszinierte mich viele Jahre mit wechselnden Schwerpunkten. Die 68er-Zeit des Aufbruchs erlaubte da viel Wildwuchs, so dass ich ab 1976 fast 20 Jahre als Psychotherapeut praktizierend und später auch lehrend tätig war.
Aber fangen wir mal ganz von vorn an: Ursprünglich wollte ich Lehrer werden, war aber kein besonders guter Schüler. Da habe ich gehört, dass man auch in der Wirtschaft als Lehrer tätig sein könne. So habe ich in Mannheim Wirtschaft studiert mit dem Ziel Handelslehrer. Im Studium begann ich dann, mich mit Hochschuldidaktik zu beschäftigen. Denn mir war schnell klar geworden, dass die herkömmlichen Lernformen wenig taugen. Die Leute müssen statt dessen miteinander reden und arbeiten, um wirklich zu lernen. Deshalb habe ich mich dann in meiner Diplom- und Doktorarbeit unter anderem mit der Gruppendynamik beschäftigt. Das war die einzige Methode, die man damals kannte, die hierzu etwas beisteuern konnte. Und so begann ich, zunächst an der Universität, später dann überregional Seminare in Gruppendynamik anzubieten. Allmählich bin ich ins freiberufliche Seminargeschäft reingewachsen, ohne dass mir damals bewusst war, was sich daraus entwickeln würde.
Anfang der 70er Jahren sind die Wellen der Humanistische Psychologie in den Heidelberger Raum geschwappt: Klientenzentrierte Gesprächstherapie, Psychodrama, Körpertherapie, Gestalttherapie und so weiter. Das habe ich dann alles mitgemacht. 1976 kam ich mit der Transaktionsanalyse in Kontakt. Ich fing sofort Feuer und begann eine systematische Ausbildung. Meine internationalen Examina machte ich 1979 als klinischer Transaktionsanalytiker in Aix-en-Provence und 1986 als Lehrtrainer und -supervisor in Barcelona. In den 80er-Jahren habe ich dann die systemische Transaktionsanalyse formuliert und über viele Jahre später mit Schwerpunkt Coaching ausgebaut. Ich war von der klassischen TA doch schon recht weit weggedriftet, als ich 2007 als europäischer Vertreter auf die internationale TA-Konferenz in San Francisco eingeladen wurde, 31 Jahre nachdem ich TA dort auf einer internationalen Konferenz kennengelernt hatte. Dort hat man mir als erstem Deutschen und weltweit erstem Vertreter des Organisationsbereichs die wohl bedeutsamste internationale Auszeichnung den „Eric Berne Memorial Award“ verliehen. Das war heilsam.
Zwischendrin hatte ich bei Milton Erickson und NLP-Vertretern studiert. Mit der Jungianischen Psychologie hatte ich mich ohnehin schon seit Jahren beschäftigt. Und über die Gruppe um Helm Stierlin in Heidelberg war ich mit dem systemischen Gedankengut in Kontakt gekommen und habe schließlich zusammen mit Gunthard Weber das Institut für systemische Therapie und Transaktionsanalyse, wie es damals hieß, gegründet. Mir erschien manches der Orientierung der TA an der Psychotherapie des letzten Jahrhunderts mit der Zeit antiquiert. Man hat ja nicht nur Defizite, Störungen und pathologische Beziehungen, sondern auch Begabungen, Kompetenzen und kreative Beziehungen! Statt den Blick dafür zu schärfen, mit wem ich mich in tragisch endende sexuelle Spiele verstricken könnte, wäre es sinnvoll zu erkennen, mit wem ich ein gutes Lern- und Arbeitsbündnis entwickeln könnte? Ressourcenorientierung macht den Unterschied und die Entwicklung professioneller Rollen.
Die damalige Psychotherapie war mir zu überwertig von einer Ideologie des ›Befreiens von etwas‹ getragen: Wenn ich, so die Annahme, Eierschalen biografischer Art, die mich noch an einer völlig freien Bewegung hindern, abstreifen würde, dann würde ich flügge werden. Das stimmt aber nicht, denn man muss auch fliegen lernen. Vielleicht schafft man es ohne die Schalen, das Nest zu verlassen und zu lernen. Ob man ein guter Flieger wird, hat aber sehr viel mit Kompetenz zu tun. Wenn man passend zum eigenen Wesen lernt, in der Welt etwas zu tun, ist das die beste psychotherapeutische Versorgung. Von daher bin ich immer eher auf der Seite der Lernkultur mit therapeutischen Effekten als auf der Seite der Psychotherapiekultur.
Dennoch hatte ich mich zwar nicht den dogmatischen Strebungen in der TA-Szene, aber doch der Professions, -Weiterbidlungs- und Prüfungskultur immer dankbar verbunden gefühlt.
Warum haben Sie sich später dazu entschieden, in die Organisationsberatung zu wechseln?
Da gab es weltanschauliche Gründe. Ich fand, dass der „Reparaturbetrieb Psychotherapie“ zwar einzelnen hilft, aber die gesellschaftlichen Probleme nicht wirksam angeht, und suchte nach weiteren Hebeln. Auch war mir selbst die systemische Orientierung dieser Zeit zu dogmatisch geworden. So war bspw. auch das systemische Therapieverständnis in sich dann einseitig oder unzureichend, wenn es die inneren Steuerungsprozesse der Menschen vernachlässigte und sich nur auf Beziehungs- Systeme fokussierte. Zudem fand ich es unpassend, Psychotherapie in gesellschaftliche Felder zu übertragen, die nach anderen Spielregeln funktionieren. Dort mussten andere Rollen, andere Kontexte, andere Beziehungslogiken und andere Verantwortlichkeiten im Vordergrund stehen. Im Organisationsbereich müssen die Selbststeuerungen und Beiträge zum System auch unter ökonomischen, rechtlichen, markt- oder branchenorientierten Gesichtspunkten Sinn machen bzw. anschlussfähig sein. Ganzheitlichkeit kann eben auch heißen, unternehmerische und andere gesellschaftliche Belange nicht nur im Prinzip mit zu berücksichtigen, sondern durch konkrete Entwicklungen von anschlussfähigen Konzepten und Vorgehensweisen.
Und dann störte mich auch die Trägheit vieler meiner Weggefährten. Sie waren auf dem Standpunkt stehen geblieben: Wir haben so tolle Dinge anzubieten, da kann jeder etwas Interessantes lernen und das Gelernte selbst in seine Welten übertragen. Mir hat das nie gereicht. Ich habe mich gefragt, was fehlt noch, was schließen wir aus, welche Berufsverständnisse exportieren wir unbemerkt? Welche Kulturinfektion ziehen sich Organisationen zu, wenn sie mit Dienstleistungen die gewohnheitsmäßigen Wirklichkeitsverständnisse und Handlungsmaxime der Anbieter ins Haus und in die Köpfe holen. Deshalb habe ich mich aufgemacht, die Konzepte der Transaktionsanalyse vom Berufsverständnis der Therapeuten zu reinigen.
Ganz praktisch bekam ich immer mehr interessante und gut honorierte Aufträge für Beratung und Workshops aus dem Organisationsbereich. So konnte ich die Welt der Unternehmen besser verstehen lernen und ausprobieren, wie ich mein Können dort nutzen konnte. Aus der konkreten Arbeit heraus entwickelte ich Konzepte, Modelle und Methoden. Sie fanden bei Kollegen Anklang und ich wurde immer mehr als Lehrer und Supervisor angefragt. So entstanden immer mehr Curricula für Professionelle im Organisationsbereich. Schließlich gab ich die psychotherapeutische Arbeit ganz auf.
Seit etlichen Jahren habe ich mit dem isb-Wiesloch nun sozusagen „meine eigene Hochschule“ aufgebaut und mittlerweile an die nächste Generation übergeben. Die Chancen, die eine Kultur ohne eine leistungsfähige Wirtschaft hat, sind nur gering. Diese Kombination aus humanistischem Bildungsideal und marktwirtschaftlichem Verantwortungsprinzip hat uns immer gezwungen, gute Kompromisse zwischen gesellschaftstauglichen Anforderungen und eigenen Wertevorstellungen zu finden.
Warum haben Sie die Schmid-Stiftung gegründet?
Ein Unternehmen, das so stark kulturgeprägt ist wie das isb, kann man nicht einfach verkaufen und jemandem übergeben, der diese Kulturtradition nicht auch pflegen kann oder möchte. Deshalb stellte ich mir die Frage, wie eine unternehmerische Nachfolge aussehen könnte? Wie meist, unter der Dusche, hatte ich plötzlich die Idee: Ich gründe eine Stiftung! Zunächst habe ich ganz naiv und einfach nur großzügig gedacht, dass ich die erheblichen wirtschaftlichen Überschüsse des Unternehmens nicht mehr brauchen werde und sie für den guten Zweck, für den das isb steht, nämlich Wirtschafts- und Gesellschaftskulturentwicklung, zur Verfügung stehen sollten. Der Zweck der Stiftung ist es, gemeinwohlorientierten Initiativen und Organisationen unser Coaching- und OE-Knowhow für ihre Entwicklung zugänglich zu machen. Aber nicht, indem wir einfach Dienstleistungen verschenken, die normalerweise gekauft werden müssten, sondern indem wir Organisationen helfen zu verstehen, wofür man Coaching- und OE-Knowhow zur eigenen Entwicklung nutzen kann und sie darin begleiten, zu lernen, wie man dieses Wissen eigenverantwortlich anwendet. Auch glaube ich, dass Individuen und Organisationen künftig einen Mix von Erwerbs- und Gemeinwohl-Orientierung entwickeln müssen und wir von Anbieterseite für solche kombinierten Entwicklungen Beispiele liefern sollten.
Inwiefern beeinflusst Ihre Persönlichkeit Ihren Coachingstil?
Von meinem Wesen her bin ich eher introvertiert. Ich habe zwar gelernt, in der Welt auch extravertiert zu sein, aber das geht bei mir nur ›auf Akku‹. Das heißt, ich brauche anschließend immer etwas Rückzug und die Erneuerung in der Introversion. Ich bin auch nicht so der wöchentliche Begleiter, eher jemand, der hilft Schlüsselsituationen für Neu-Orientierung zu kreieren und dann loslässt, bis sich die Impulse ausgewachsen haben oder neue Aspekte auftauchen. Als Ideenfinder und -entwickler kann ich am besten mit Menschen arbeiten, die ich nicht tragen muss, sondern anregen kann, so dass sie dann selbstständig weiterarbeiten können. Da muss ich dann auch nicht mehr dabei sein.
Mir fällt es eher schwer, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die viele „Wiederholungs-Runden“ drehen müssen. Da wird dann mein Drang nach Fortschritt zu sehr gebremst. Das hatte schon nach vielen Jahren Einzeltherapie dazu geführt, dass ich vor allem Arbeit in der Gruppe gemacht habe. Denn da konnte ich immer mit denen arbeiten, bei denen Entwicklung gerade möglich war. Später habe ich feste Rhythmen ganz aufgelöst und nur noch dann neue Termine vergeben, wenn ich den Eindruck hatte, dass die Klienten wirklich etwas bewegen möchten oder dass sie das in vorigen Sitzungen Erarbeitete auch verwerten. Auch deswegen gab es immer Tonaufnahmen von Sitzungen. So können Anregungen, falls sie im Moment der Sitzung nicht integriert werden, durch das wiederholte Hören Schicht für Schicht aufgenommen werden.
Dieses Prinzip des Auf-Augenhöhe-Seins mit dem Gegenüber ist mir wichtig. Deswegen ist es für mich in der Beratungsarbeit immer entscheidend, dass man erst einmal eine gemeinsame Lern- und Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe errichtet. Natürlich muss man mit dem Klienten darüber sprechen, wo er oder sie eigentlich hin will, damit man nicht einfach irgendwas macht. Ich selbst spreche aber nicht gern von einem Ziel, sondern eher von einer Richtung. Was Richtung dabei meint, ist nicht immer leicht zu operationalisieren. Intuitiv haben wir die Fähigkeit, bei der Beschreibung von sinnvollen Richtungen bedeutsame, aber ganz verschiedene Dimensionen zusammenzubringen und zu integrieren Wir versuchen dies in unseren Gruppen durch verschiedene Spiegelungsübungen zu trainieren.
Dafür ist es wohl erforderlich, eine gewisse Offenheit für neue Erfahrungen mitzubringen, oder?
In Sachen Offenheit hat uns Milton Erickson den Weg gewiesen: Zum Beispiel soll er früher seine Ausbildungskandidaten vors Haus geführt und sie aufgefordert haben, sich den gegenüberliegenden Hügel anzuschauen. Auf diesem Hügel waren aufgrund des Windes, der von Nord nach Süd wehte, alle Bäume außer einem etwas nach rechts geneigt. Und da sagte Erickson, dass dieser eine Baum den Klienten repräsentieren könnte. Dies ist eine wunderbare Metapher dafür, dass es im Einzelfall immer wieder anders sein kann und wir uns trotz aller Erfahrungen und Empirie ein neues Urteil bilden müssen. Erickson hat Schemata ganz klar abgelehnt, er wollte vielmehr, dass die Menschen metaphorisch und an Beispielen solche Schöpfungsakte miterleben und eine entsprechende Haltung einnehmen können. Das Überraschende, das das Leben an mich herangetragen hat, war oftmals sehr lehrreich – und zwar sowohl in positiven Aspekten als auch in situativ manchmal sehr unangenehmen Geschehnissen oder Enttäuschungen.
Wie gehen Sie mit beruflichen Misserfolgen um?
Bei meiner Arbeit läuft die Selbstreflexion eigentlich immer mit. Im Laufe der Zeit entwickelt man ein Gefühl für Stimmigkeit und Richtigkeit. Ich glaube, dass Reflexion immer etwas mit dem Denkstil und der eigenen Nachdenkkultur zu tun hat. Da bin ich sehr eigen. Wenn ich etwa bemerke, dass etwas irgendwie danebengegangen ist, dann nehme ich mir Zeit, um herauszufinden, was ›das‹ war und was richtig sein könnte. Oder ich merke mir zumindest die Situation. Dann sage ich mir, dass es in Ordnung ist, jetzt nichts ungeschehen machen zu wollen. In den meisten Fällen habe ich nicht das Bedürfnis, mit Leuten darüber zu sprechen, und kann das Problem dann auch ruhen lassen!. Dann arbeitet ›es‹ in mir und irgendwann morgens unter der Dusche macht es klick – ich bin mit dem Thema auf einem neuen Niveau angelangt und es ist erst einmal abgeschlossen. Wenn ich also merke, dass etwas nicht passt, initiiere ich automatisch Suchprozesse, um herauszufinden, was da genau schiefgelaufen ist. Ich bin eher der Typ, der das sehr fein beobachtet, für sich verarbeitet und nicht alle möglichen Leute fragt. In der Regel komme ich dann auch zu Einsichten, selbst wenn ich diese nicht immer gleich gut umsetzen kann.
Was zeichnet einen guten Coach aus?
Ein guter Coach versteht sowohl Menschen als auch Organisationen – und er überträgt nicht einfach Psycho-Beratung. Er hat eine solide Ausbildung sowie Erfahrung im Organisationsbereich. Wichtig ist auch die Lebenserfahrung: Ein guter Coach hat Augenmaß und springt nicht auf jede Mode auf. Er gehört keiner Sekte an und hat kein sektenähnliches Denken. Wenn ein charismatischer Coach sektenähnlich auftritt, kann er Verantwortliche auf seltsame Trips bringen. Das kann zu pseudokompetenten Haltungen führen, die an der eigentlichen Problematik vorbeigehen. Zudem tauscht ein guter Coach Erfahrungen und Informationen mit Berufskollegen aus. Das wäre es in etwa.
Was macht Ihrer Ansicht nach einen gelungenen Coachingprozess aus?
Um das zu beantworten, würde ich gern einen Schritt zurückgehen. Coaching ist für mich nicht in erster Linie das Arbeiten mit bestimmten Methoden oder einem bestimmten Ablaufschema. Für mich ist (Professions- und Organisations-)Coaching vor allem die Entwicklung einer integrierenden Perspektive in der Beziehung von Mensch zur Berufswelt und von Mensch zur Organisationswelt. Wenn man diese beiden Pole aufmacht, heißt das, dass man die Berufswelt und ihre Auswirkungen genügend studieren und am Puls der Evolution arbeiten muss, um die Menschen und Organisationen zukunftsfähig zu machen. Ich muss quasi irgendwelche Bilder von der Entwicklung von Organisationen und der Gesellschaft schaffen, um im Umkehrschluss daraus ableiten zu können, was das für den einzelnen Menschen heißt. Die meisten Menschen fragen ja gern, ob die Organisation und der Beruf, in dem sie arbeiten, Sinn stiften. Aber es ist ja auch immer die zweite Frage relevant: Mache ich Sinn für dieses Berufsfeld und für diese Organisation? Und, weiter gedacht, wie passe ich in die Gesellschaft und ihre Entwicklung? Wenn man Coaching als Expertise versteht, heißt das, dass ich für Anschlussfähigkeit verantwortlich bin, weil menschliche und gesellschaftliche Prozesse immer ganzheitlicher Natur sind. In diesem Kontext haben wir im Deutschen Bundesverband Coaching (DBVC) auch die dialogische Qualitätssicherung eingeführt, die darauf abzielt, sich im Dialog immer wieder mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und sich gemeinsam – ungeachtet irgendwelcher Normen – weiterzuentwickeln.
Woran kann man denn erkennen, ob ein Coaching tatsächlich hilfreich war? Wie kann man also messen, ob und mit welchem Erfolg es zu den erhofften Entwicklungen geführt hat?
Hierzu fällt mir der Begriff „zirkuläre Evaluation“ ein: Wenn jemand bspw. ein Coaching macht, das er nicht selbst finanziert, gibt es ja irgendwelche Stakeholder, die wollen, dass irgendetwas anders wird, weshalb sie das finanzieren und Zeit dafür bereitstellen. Und wenn man einen Kontrakt macht, macht man den dann ja nicht nur mit dem Coachee, sondern zugleich auch mit der Organisation oder anderen Stakeholdern. Man muss demzufolge klären, wer das ist und was sie für Vorstellungen haben, was in ihren Augen also Fortschritte wären. Dazu muss man m. E. vor allem miteinander sprechen. Coaching soll ja etwas bringen, das für andere Menschen spürbar ist. Allerdings warne ich davor, das völlig zu operationalisieren. Ich halte also nichts von irgendwelchen Fragebögen, da sich komplexe Entwicklungsprozesse durch diese (wenn überhaupt) nur oberflächlich erfassen lassen. Wir Menschen sind intuitive, sinnbegabte Wesen, die ein Gespür dafür haben, wenn sich etwas Gutes entwickelt.
Obwohl ich selbst eine Ausbildung zum „Systemischen Business Coach“ absolviert habe, stehe ich keinem Verband nahe. Sie hingegen sind Ehrenvorsitzender im Präsidium des DBVC. Welche Vorteile sehen Sie für Menschen wie mich, sich einem solchen Verband anzuschließen?
Solchen Formulierung begegnet der DBVC immer wieder. Als Gegengewicht habe ich immer formuliert: Der DBVC ist eine Investorengemeinschaft! Wer zur Kulturbildung im Coaching aus weltanschaulichen Gründen beitragen will, findet dort dafür einen guten Rahmen und Gleichgesinnte. Ob es sich für die, die nur Renommee und Vorteile suchen, lohnt, weiß ich nicht zu sagen. Ich wäre dafür nicht beigetreten und wir Gründer haben ihn nicht dafür gegründet. Am wichtigsten ist die eigene Passion, ein guter Coach zu sein und mit sich und anderen dabei wahrhaftig, wesentlich und verantwortlich sein zu wollen. Dafür braucht man keinen Verband. Lebendiger Austausch in Communities reicht. Verbände und eine rechtlich geschützte Profession Coaching bringen alle Probleme einer Institutionalisierung mit sich. Verkirchlichung kann Verkrustung, Vereinsmeierei und Funktionärsherrschaft auf der einen Seite und stabile Rahmen, Nachhaltigkeit und Schutz gegen Tagesmoden auf der anderen Seite bedeuten. In jeder gesellschaftlichen Institution ist diese Spannung angelegt. Jeder muss herausfinden, wie er sich dazu stellen kann. Mein Engagement im DBVC war dadurch getragen, dass ich Mitstreiter/-innen gefunden habe, die einen lebendigen und kompromissfähigen Verband auf den Weg gebracht haben, der lebendige Qualität und offenen Diskurs mit Meinungsführerschaft und einer gewissen Expertenmacht kombiniert. Es scheint uns nachhaltig recht gut gelungen zu sein, hier einen Leuchtturm gegen manche Irrlichter zu etablieren. Ob dies über die Zeit erhalten werden kann, weiß ich nicht.
Haben Sie eine Art „Lebensmotto“?
»Wenn Du etwas in unserer Welt vermisst, sorge mit dafür, dass es in die Welt kommt.« Ich habe für Jammern und das Beklagen von Mangel nie viel übrig gehabt. Mich berührt, wenn jemand auch mit Beeinträchtigungen seinen Lebensweg eigenverantwortlich und mutig zu gehen versucht, sich nicht unnötig mit Defiziten beschäftigt, sondern aus dem Holz, aus dem er nun mal gewachsen ist, etwas Taugliches macht. Unangepasstheiten sind für mich noch nicht ins Gleichgewicht und ins richtige Zusammenspiel gebrachte Kompetenzen. Ich machte mich immer für das Ergänzende, was meiner Ansicht nach fehlte, stark. Schon als Therapeut war ich dafür, Unangepasstheiten nicht wegzutherapieren, sondern zu helfen, dass sie sich im richtigen Zusammenspiel und Zusammenhang zum Guten entwickeln. Mein Bonmot war: aus Neurose Charakter machen.
Gibt es etwas, das Sie jenen Menschen ans Herz legen bzw. mit auf den Weg geben möchten, die sich dafür interessieren, selbst Coach zu werden? Was wäre Ihre Botschaft an den Nachwuchs der Coaching-Szene?
Was sollte ich auswählen aus den vielen Erfahrungen und Einsichten, die mir das Leben beschert hat? Und wer weiß, was davon für jemand anderen bedeutsam werden kann? Mir kommt allenfalls ein Spruch aus meiner christlichen Vergangenheit in den Sinn: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“
Was meine ich bloß mit Seele? „Ich stelle mir meine Seele wie ein unsichtbares Fischernetz vor. Es hängt an Bojen, die an der Oberfläche sichtbar sind, doch das Netz reicht in Tiefen, die ich letztlich nicht ausloten kann. Das Netz selbst kann ich auch nicht wahrnehmen. Ich bekomme aber eine Vorstellung davon, durch das, was darin hängen bleibt. Allein, dass etwas geblieben ist, zeigt, dass es mit mir zu tun hat. Was geblieben ist, sagt etwas über das Netz. Wichtig ist, was bei jedem hängenbleibt. Es erzählt von Ihm.“
Vielen Dank für das Interview!
Dr. Bernd Schmid ist Leitfigur des isb-Wiesloch www.isb-w.eu, der Schmid-Stiftung http://schmid-stiftung.org/ und des International Network for Organization Development and Coaching www.inoc-network.org. Er ist u.a. Ehrenvorsitzender Präsidium DBVC, Ehrenmitglied der Systemischen Gesellschaft, Preisträger des EATA-Wissenschaftspreises 1986 und des Eric Berne Memorial Award 2007 der Internationalen TA-Gesellschaft, Life Achievement Award 2014 der deutschen Weiterbildungsbranche. Life Achievement Award der deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse 2017.
Literaturhinweise:
- Bernd Schmid & Thorsten Veith (2014). Systemische Organisationsentwicklung: Change und Organisationskultur gemeinsam gestalten. Schäffer Poeschel.
- Bernd Schmid & Andrea Günter (2012). Systemische Traumarbeit. Der schöpferische Dialog anhand von Träumen. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Bernd Schmid & Christiane Gérard (2012). Systemische Beratung jenseits von Tools und Methoden. Mein Beruf, meine Organisation und ich (EHP-Handbuch Systemische Professionalität und Beratung). EHP Edition Humanistische Psychologie.
Kostenlose Downloads:
- Bernd Schmid (1994). Wo ist der Wind, wenn er nicht weht? Professionalität und Transaktionsanalyse aus systemischer Sicht. Junfermann.
- Bernd Schmid & Andrea Mikoleit (2017). Und der Haifisch, der hat Zähne – Umgang mit Macht, Angst und persönlicher Stärke. tredition GmbH.
- Bernd Schmid (2016). Verantwortung – Last und Würde – Essays. tredition GmbH.
- Bernd Schmid unter Mitarbeit von Jutta Werbelow (2016). Am Zaun – persönliche Essays. isb-Wiesloch.
- Bernd Schmid unter Mitarbeit von Rainer Müller (2016). Psychotherapieschulen und ihre Schlüssel-Ideen. Gründer – Stories – Extrakte. tredition GmbH.
- Bernd Schmid (2014). Persönliche Leitbilder und berufliche Lebenswege. isb-Wiesloch.