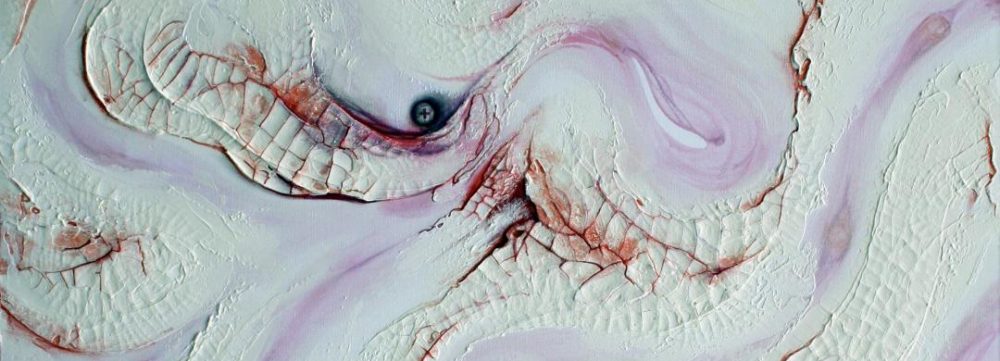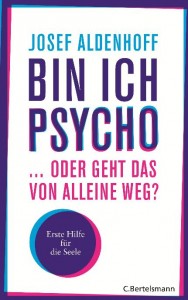Prof. Dr. Josef Aldenhoff sprach auf der Tagung unseres Psychologen-Forums in Regensburg über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Psychotherapie. In diesem Zusammenhang haben sich bei mir im Nachhinein einige Fragen aufgeworfen, die in dem folgenden Interview diskutiert werden.
Prof. Dr. Josef Aldenhoff: Psychotherapie heute – Vision und Realität
Zitat (aus der Vorankündigung des Vortrags): „Seit den 80-ger Jahren hat sich die psychotherapeutische Landschaft von Grund auf verändert. Statt der Dichotomie zwischen Tiefenpsychologie (inkl. Psychoanalyse) und Verhaltenstherapie steht heute eine Vielzahl von störungsspezifischen, evidenzbasierten Therapien zur Verfügung. Fast jedes psychiatrische Krankheitsbild kann heute ganz, oder in wesentlichen Teilen spezifisch psychotherapeutisch behandelt werden. Diese Situation ist für Patienten wie Therapeuten sehr komfortabel.“
Trotz dieser Vielzahl von störungsspezifischen (evidenzbasierten) Therapien scheint es noch immer eine recht große Gruppe von Patienten zu geben, deren Krankheitsverläufe sich chronifizieren. Als Laie könnte man sich die Frage stellen, woran das liegt? Worin sehen Sie die wesentlichen Gründe hierfür?

Prof. Dr. Josef Aldenhoff
Wir wissen nicht genau, was die Voraussetzungen für Chronifizierung sind. Je allmählicher sich eine Störung entwickelt, desto langsamer wird wahrgenommen, dass etwas nicht stimmt. Und desto länger versuchen die Betroffenen und ihre Umgebung, andere Erklärungen zu finden. So lange nicht klar ist, dass es sich um eine behandlungsbedürftige Störung handelt, so lange gibt es keinen Ansatz für Therapie. Je länger und mehr sie die Veränderungen in Befinden und Erleben kognitiv verarbeitet haben, desto weniger sind sie bereit, den großen Schritt zu tun und sich auf eine Therapie einzulassen. So gesehen sind sehr akute Störungen günstiger als solche, die sich sehr allmählich entwickeln. Bei ihnen ist der Leidensdruck und die Motivation zur Veränderung größer.
Ein anderer Grund für Chronifizierung ist die mäßige Verfügbarkeit von wirklich gut ausgebildeten Therapeuten und dass es immer noch keine verpflichtenden Regeln für die Umsetzung von Leitlinien gibt: ich sehe zum Beispiel immer wieder Patienten, die über Jahre bei einer Zwangs- oder Angststörung über Jahre tiefenpsychologisch behandelt werden! Ohne irgendwas gegen die Tiefenpsychologie sagen zu wollen, – bei diesen Störungen bringt sie nun mal nichts, auch wenn sich Klienten und Therapeuten über viele Sitzungen angeregt unterhalten mögen. Das Ende vom Lied ist dann ein Angstpatient, der alles oder noch viel mehr über seine Störung weiß, aber jede Form von Exposition vermeidet.
In dem Buch „Irren ist menschlich“ von Klaus Dörner et al. Habe ich z. B. am Ende des Kapitels über die Depression gelesen, dass man – trotz aller wissenschaftlicher Bemühungen, die Bedingungen ihrer Entstehung zu erforschen – eigentlich nicht genau wisse, warum Menschen depressiv werden. Könnte es sein, dass vielleicht nicht nur die Ursachen einzelner Erkrankungen unzureichend geklärt, sondern auch die Diagnosen (ICD-10), anhand derer eine störungsspezifische Therapie eingeleitet wird, in einigen Fällen einfach zu ungenau sind?
Natürlich sind manche Diagnosen schwer zu stellen, obwohl das im Zeitalter von ICD-10 schon wesentlich einfacher ist, als früher. Während meiner Ausbildung habe ich noch erlebt, dass zwei langjährig im Fach tätige psychiatrische Oberärzte ein und denselben Patienten ausführlich exploriert haben und dann zu völlig unterschiedlichen Diagnosen kamen! Das kommt heute wohl kaum noch vor. Und die störungsspezifischen Therapien erfordern ja ihrerseits durchaus diagnostische Vorgaben.
Wir wissen nicht bei jedem Menschen, warum er depressiv wird, bzw. die Ursachen können sehr unterschiedlich sein. Aber wenn er einmal depressiv ist, dann zeigt er ganz bestimmte, individuell gefärbte aber nicht völlig individuelle Symptome und Verhaltensmuster, die sich nach Manual behandeln lassen.
Zitat: „Im Genehmigungsverfahren der Krankenkassen wird immer noch von der alten Dichotomie ausgegangen; will man moderne Verfahren anwenden, so muss man das unter dem Deckmantel einer der alten Therapien tun.“
Unter dem Begriff der „modernen“ Kognitiven Verhaltenstherapie werden ja inzwischen zahlreiche neuere Ansätze subsumiert (wie z. B. die Schematherapie oder die Mindfulness Based Cognitive Therapy etc.)…
Vielleicht sollte man nicht alle neuen Methoden in einen Topf werfen? Schematherapie ist sicher nicht unter Kognitive Verhaltenstherapie zu subsumieren.
Ja, das war ungenau. Die Schematherapie – so habe ich es bislang jedenfalls verstanden – ist eine Weiterentwicklung, die gezielt für Nonresponder auf KVT entwickelt wurde und Techniken humanistischer Therapien integriert. Was spricht dafür bzw. dagegen, entsprechende Behandlungen mit den Krankenkassen auf diesem Wege abzurechnen?
Die Lobby spricht dagegen. Es hat zum Beispiel sechs Jahre (nach Beantragung) gedauert, bis EMDR beim Gemeinsamen Bundesausschuss als Methode anerkannt wurde.
Was spräche denn aus fachlicher Sicht dafür oder dagegen?
Eigentlich spricht alles dafür: Den Psychotherapeuten/-innen wäre es leichter möglich, ehrlich zu sagen, was sie genau tun. Aber ich glaube, dass niedergelassene Therapeuten gegenüber Kassen und Gremien häufig zu wenig selbstbewusst auftreten.
Interessant fand ich die Anmerkung, dass es inzwischen eine große Vielzahl von Methoden gibt, die bspw. von vielen Coachs oder Psychologischen Beratern scheinbar beliebig eingesetzt werden. Die „intuitive“ Auswahl bzw. Vorgehensweise basiert allerdings nicht selten auf (mehr oder weniger umfangreichen) praktischen Erfahrungen. Wenn es demnach nun aber bereits für „Experten“ schon nicht immer ganz einfach ist, sich für die „richtige“ Methode zu entscheiden, wie sollten Laien (also potenzielle Klienten/-innen bzw. Patienten/-innen) das dann tun? Was könnte ihnen hierbei helfen?
Die Laien können das nicht. Das ist auch gar nicht ihre Aufgabe. Therapeuten müssen den Patienten, die zu ihnen kommen, einen Therapievorschlag machen, die Methode erklären, ihre Wirkungsweise und ihre Nebenwirkungen und nach Möglichkeit auch die Evidenzlage. Dann kann der kranke Laie zurückfragen und entscheiden, ob er sich so eine Therapie zutraut oder nicht. Er braucht also Psychoedukation, um sich entscheiden zu können. Generell finde ich, dass der Betroffene die wesentliche Person bei der Entscheidung über Therapie ist. Therapeuten sollten sich nicht schlauer vorkommen als ihre Klienten, sondern sie sollten alles tun, damit sich die Klienten sinnvoll entscheiden können.
Der Weg zum Psychologischen Psychotherapeuten ist äußerst steinig. Fleiß, hervorragende Leistungen sowie eine entsprechende Begabung scheinen allerdings nicht auszureichen, um ihn mit Erfolg beschreiten zu können. Viele junge Psychologen/-innen können sich eine solche Ausbildung einfach nicht leisten. Was halten Sie davon, das es gerade bei einem so anspruchsvollen Beruf wohl vor allem darauf ankommt (sozusagen als eines der entscheidenden Auswahlkriterien), über hinreichend finanzielle Mittel zu verfügen, um ihn erlernen und ausüben zu können?
Das ist kein Zustand, dass die Psychologen die Psychotherapieausbildung so teuer bezahlen müssen, was in vielen Fällen bedeutet, dass sich junge Menschen gleich zum Anfang ihrer Berufslaufbahn verschulden müssen! Vom Studium her bringen Psychologen sehr viel mit, um therapeutisch mit Menschen zu arbeiten. Man sollte sich hier von der Medizinerausbildung leiten lassen, die ja den Psychotherapietitel im Rahmen ihrer Facharztausbildung ohne zusätzliche Kosten bekommen.
Zitat: „Evidenzbasierte Psychotherapien sind ausnahmslos manualisiert und mit genauen Vorgaben zu ihrer Durchführung versehen. In der Praxis kann das zu Schwierigkeiten führen, wenn ein Therapeut im Laufe des Tages Patienten mit verschiedenen Diagnosen behandelt und sich dabei immer wieder auf andere Manuale beziehen muss.“
Wie kann man mit dieser Entwicklung sinnvoll umgehen? Sollten sich praktizierende Psychotherapeuten/-innen eventuell künftig vermehrt auf einzelne Störungsbilder spezialisieren?
Das wäre wahrscheinlich gut. Es setzt allerdings voraus, dass sich Therapeuten zu einem Verbund zusammen tun, der das ganze benötigte Spektrum an Therapie anbietet. Dann hätte der Einzelne genügend Zeit, mit den unterschiedlichen Therapien gründliche Erfahrungen zu sammeln.
Außerdem hat die Möglichkeit, immer mal wieder zu wechseln, durchaus ihren Charme. Immer nur Traumatherapie, oder immer nur mit chronischen Depressiven zu arbeiten kann sich schon aufs Gemüt schlagen. Auch die Supervision ließe sich so besser organisieren.
Zitat: „Die Stärke der störungsspezifischen Therapien liegt ohne Zweifel im evidenzbasierten Nachweis ihrer Wirksamkeit. Um diese Stärke nicht zu verlieren, müssen die Bedingungen genau einhalten, unter denen der Wirksamkeitsnachweis geführt wurde. Zur Überprüfung sind regelmäßige Supervisionssitzungen nötig. Es bestehen gewisse Zweifel, dass dieses Vorgehen auch unter den Bedingungen der niedergelassenen Psychotherapie überall beachtet wird.“
Natürlich ist eine regelmäßige Supervision mit einem gewissen Aufwand verbunden (Zeit und Geld) und gegebenenfalls auch unbequem. Was sind Ihrer Meinung nach die wesentlichen Gründe dafür, dass es Psychotherapeuten/-innen zu geben scheint, die sich diesem Prozedere entziehen? Und wie könnte man dieses Problem lösen?
Wahrscheinlich ist es sehr menschlich, dass wir nicht immer beaufsichtigt werden oder Rechenschaft ablegen wollen. Man kann auch in Therapie schön in den flow kommen, wenn sie gut läuft. Das Aufnahme- oder Videogerät ist da eher hinderlich. Ich erinnere mich noch gut, wie ich einmal eine Sitzung zu Supervisionszwecken mitgeschnitten habe, natürlich mit dem Einverständnis der Patientin, und es lief von Minute zu Minute schlimmer, ich blockierte immer mehr und hätte das Teil am liebsten ausgeschaltet.
Das andere ist, dass Supervision bisher von den Kassen nicht gezahlt wird und das geht nicht. Supervision macht ja nur Sinn, wenn ganz normale Therapiesitzungen supervidiert werden und das ist ja nicht nur im Sinn der Therapeuten, sondern durchaus in dem der Klienten. Also gehört Supervision zur Therapie und muss entsprechend bezahlt werden.
Sie haben in Ihrem Vortrag u. a. über die Grundwirkkomponenten von Psychotherapie gesprochen und infrage gestellt, inwieweit sich aus ihnen störungsspezifische Manuale erstellen ließen? Welche Komponenten sind das genau? Und was spricht eigentlich gegen die Idee, sich bei der Konzeption von Manualen an diesen zu orientieren und entsprechende Interventionen vorzuschlagen?
Zur Zeit wird an den therapieübergreifenden Elementen ziemlich intensiv geforscht, bspw. von Prof. Lisa Schramm aus Freiburg oder Prof. Martin Bohus aus Mannheim. Es ist zu erwarten, dass dabei auch Impulse für die praktische Therapie herauskommen. Allerdings darf man nicht zu schnell zu viel erwarten, denn alle neuen Ideen und Impuse müssen natürlich auch erst wieder evaluiert werden.
Können Sie sagen, was da genau erforscht wird, und vielleicht auch die Komponenten benennen, um die es dabei geht?
Bei den “Grundwirkkomponenten” geht es um Therapie-Elemente, die verschiedenen Therapien gemeinsam sind. Dabei zeichnet sich ab, dass Fertigkeiten wie Emotionsregulation und Bewusstsein für die eigene Emotionalität, das Verständnis für die Art und das Ausmaß an Empathie meines Gegenübers und die Fähigkeiten zur sozialen Kommunikation Grundmerkmale für psychische Störungen und auch Grundelemente sind, die in der Therapie sinnvoller Weise angegangen werden können.
Als Psychologe habe ich den Auftrag, angehende Psychologische Berater bzw. Heilpraktiker für Psychotherapie auf ihre Prüfung sowie auf die praktische Tätigkeit vorzubereiten. Für diese Aufgabe, nämlich die professionelle Entwicklung meiner Teilnehmer/-innen zu fördern und zugleich einen Raum zu schaffen, in dem Selbsterfahrungen möglich sind, habe ich allerdings nur ein sehr begrenztes Kontingent an Stunden zur Verfügung. Worauf sollte ich hierbei Ihrer Meinung nach besonders achten, damit diese (knappe) Zeit wirklich sinnvoll genutzt werden kann?
Folgende Fragen sollten dabei meiner Ansicht nach im Vordergrund stehen:
- Wie gehe ich respektvoll mit den Menschen um, die zur Beratung oder Therapie kommen? Hierbei spielt m. E. vor allem die therapeutische Haltung eine wichtige Rolle, die von bedingungsfreier Wertschätzung, Empathie und Kongruenz (Echtheit) geprägt sein sollte.
- Ist das Problem, das von dem Klienten bzw. der Klientin vorgetragen wurde, wirklich bearbeitet worden? Welchen Auftrag habe ich als Berater oder Therapeut? Wurde das Ziel erreicht (Evaluation)? Welche Bedeutung hat eine Supervision?
Wichtig ist es zudem, eventuelle Suizidgedanken der Klienten/-innen ernst zu nehmen!
In Ihrem Buch „Bin ich psycho… oder geht das von alleine weg?“ beschreiben Sie auf beeindruckende Weise verschiedene Störungsbilder aus Sicht der Betroffenen. Welche Rückmeldungen haben Sie von Ihren Lesern/-innen bekommen?
Es gibt viele differenzierte, in anspruchsvollem Stil geschriebene Bücher über Psychiatrie und psychische Störungen, bei denen man das Gefühl hat, es ginge ihnen letztlich gar nicht darum, für die Betroffenen verständlich zu schreiben. Die Menschen sollten aber verstehen können, was sie betrifft. Sprache hat schließlich ein großes Potenzial, sich selbst wiederzuerkennen. Oft bekam ich die Rückmeldung, ein empathisches Verständnis für die Betroffenen zu zeigen.
Prof. Dr. Josef Aldenhoff war viele Jahre Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Heute ist er vorrangig als Psychotherapeut, Coach, Berater und Autor tätig.
Kontakt: http://www.josef-aldenhoff.de