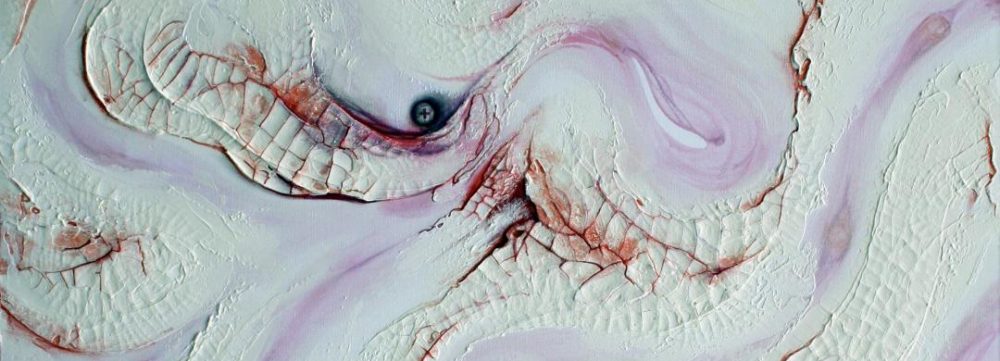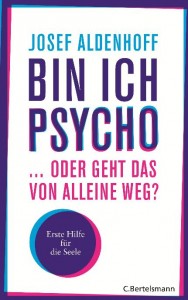Manfred Evertz
Kennen Sie Menschen, mit denen Sie über alles sprechen können, die Ihnen zuhören, dabei interessiert nachfragen und Sie nicht für das verurteilen, was Sie tun oder sagen? In einer Psychotherapie sollte es eigentlich genau so sein. Entscheidend für den Aufbau einer funktionierenden Arbeitsbeziehung sei es, dass Therapeuten ihren Patienten wertschätzend, empathisch und zugleich kongruent begegnen, weiß man spätestens seit Carl Rogers. Auf diese Weise erleichtern sie es diesen, Vertrauen zu fassen und konstruktiv an der Entwicklung ihrer Persönlichkeit bzw. an der Lösung ihrer Probleme zu arbeiten.
Bereits Frederick Kanfer, Professor für Psychologie an der University of Illinois und ein Pionier der Verhaltenstherapie, betonte die Bedeutung der therapeutischen Allianz. Seither ist es nahezu unbestritten, dass die funktionierende Zusammenarbeit von Patient und Therapeut einen wesentlichen Einfluss auf die Wirksamkeit einer Psychotherapie hat.
Edward S. Bordin, Professor für Psychologie und Pädagogische Psychologie an der University of Michigan, postulierte 1979 drei zentrale Bestandteile, die eine therapeutische Allianz ausmachen:
- die Entwicklung einer emotionalen Bindung (Bond)
- die Übereinstimmung bezüglich der Therapieziele (Goals) und
- die Übereinstimmung, was die therapeutischen Aufgaben betrifft (Tasks).
Unter „emotionaler Bindung“ verstand er, dass die gemeinsame Arbeit auf Vertrauen und gegenseitiger Verpflichtung basiert. Zudem sei es zentral, eine Übereinstimmung bezüglich der anzustrebenden Therapieziele zu finden, die angewandten Interventionen oder Techniken abzustimmen und die Rahmenbedingungen sowie die Regeln der Therapie zu vereinbaren.
Besonders wichtig wird die „emotionale Bindung“ vor allem dann, wenn es um die Behandlung psychischer Störungen geht, deren Ursprung in der mangelnden Einfühlung bzw. in einer unangemessenen Zuwendung der Eltern oder wichtiger Bezugspersonen liegt. Beim Reparenting bspw. soll seitens des Therapeuten die schädigende Wirkung verinnerlichter elterlicher Bilder oder Repräsentanzen mittels einer korrektiven Atmosphäre zwischenmenschlichen Kontaktes verändert und jene Beziehungsqualitäten zur Verfügung gestellt werden, die zur Ausbildung einer starken Persönlichkeitsstruktur notwendig gewesen wären. Hierbei müssen allerdings sämtliche Formen der Zuwendung in Worten, Blicken oder Berührungen innerhalb des therapeutischen Rahmens liegen und dürfen keinerlei missbräuchlichen Charakter annehmen. Das Wahren einer professionellen Distanz ist also unabdingbar.
Auf der Webseite der Bundespsychotherapeutenkammer (BptK) findet sich hierzu ein passendes Zitat ihres Präsidenten Prof. Dr. Rainer Richter: “Die Beziehung zwischen Patient und Psychotherapeut ist durch eine besondere emotionale Intensität und Offenheit gekennzeichnet. Der Erfolg einer Psychotherapie hängt entscheidend vom Vertrauen in diese Beziehung ab.”

Manfred Evertz
So weit, so gut. Nun mag es allerdings Menschen geben, die Derartiges nicht gewohnt sind und deshalb besonders empfindsam darauf reagieren. Die empathische Zuwendung, die nahezu unerlässlich ist, kann irritieren oder verunsichern. Beim Bewirken einer Gefühlsaktualisierung bzw. Regression können aber auch emotionale Reaktions- und Verhaltensmuster abgerufen werden, die mit einer bedauerlich unzulänglichen Impulskontrolle einhergehen. Nicht selten wird die therapeutische Beziehung mit entsprechend „pathologischer Energie“ vereinnahmt bzw. werden Therapeuten zu Erfüllungsgehilfen frühkindlicher Bedürfnisse auserkoren. Solange diese damit professionell umgehen, ist das zwar kein Problem, leider aber scheint dies nicht immer möglich zu sein. Das oben erwähnte Vertrauen kann demnach auch deshalb schwinden, weil Therapeuten eben keine Roboter sind.
„Da macht jemand nur einen Job.“
Im Verlauf einer Psychotherapie entsteht also eine Quasi-Beziehung zu einem Menschen, der sich als Privatperson kaum zu erkennen geben bzw. sich seiner beruflichen Rolle stets bewusst bleiben sollte. Es stellt sich dann leicht die Frage, ob die damit einhergehende Zuwendung nur ein Mittel zum Zweck ist („erfolgreiche Behandlung“) oder ob man sich als Patient wirklich wertgeschätzt und angenommen fühlen darf? Wie sehr darf man sich auf eine derartige Begegnung freuen? Wie intensiv dürfen die Gefühle sein, die man seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin entgegenbringt?

Manfred Evertz
Selbstzweifel, Gefühle von Scham oder Schuld (bspw. bei möglichen Grenzüberschreitungen) sowie inadäquate Reaktionsmuster von Patienten, können im therapeutischen Rahmen beleuchtet und zielgerichtet aufgearbeitet werden. Das erfordert allerdings eine professionelle Handhabung, vor allem denn, wenn es aufgrund der Intensität der oben genannten Emotionen zu Störungen auf der Beziehungsebene kommt. Übermäßig zum Ausdruck gebrachte Idealisierung bzw. Verehrung, regressive Verhaltensmuster, ebenso wie das Gefühl, einer Gegenübertragung oder projektiven Identifikation ausgeliefert zu sein, können beängstigend sein. Verunsicherung entsteht dann von Zeit zu Zeit nicht nur hinsichtlich der psychischen Stabilität der Patienten. Kommen Therapeuten deshalb zu der Einschätzung, einen therapeutischen Prozess nicht mehr hinreichend steuern zu können bzw. als Person zu stark von einem Patienten vereinnahmt zu werden, führen entsprechende Eingeständnisse fachlicher oder persönlicher Grenzen in der Regel zu einer vorzeitigen Beendigung bzw. zum Abbruch der Therapie. Obwohl das vollkommen legitim und zu befürworten ist, können die Folgen für die Hilfesuchenden fatal sein: Jetzt haben sie endlich einmal Vertrauen aufgebaut, und schon wieder werden sie enttäuscht. Noch schlimmer ist es, sollten Therapeuten zu vergleichbaren Übergriffen neigen.
Derlei Erfahrungen erschweren den ohnehin schon beschwerlichen Weg noch mehr. Wie viel Kraft muss jetzt aufgebracht werden, um sich erneut auf eine vergleichbare Beziehung einlassen zu können? Der Angst davor, erneut zurückgewiesen zu werden, folgt nicht selten eine emotionale Verhärtung, die zwar eigentlich nur dem eigenen Schutz dient, aber unangenehme Begleiterscheinungen mit sich bringt. Mit der nun spürbar werdenden Einsamkeit, Trauer bzw. mit dem Gefühl, abermals verlassen worden zu sein, müssen die Patienten daraufhin allein zurechtkommen. Die Konsequenz davon kann Verbitterung oder sogar ein finaler Rückzug mit dem Fazit sein: „Mir kann ohnehin nicht geholfen werden.“
Archaische Verstrickungen?
Nicht nur in einer Psychotherapie, sondern eigentlich überall dort, wo Menschen sich um die Sorgen anderer Menschen kümmern, entsteht eine besondere Form der Nähe und – wird diese eine gewisse Weile ausgehalten – eine zwischenmenschliche Beziehung, die sich für die Beteiligten jeweils anders darstellt. Selbst wenn der Rahmen professionell abgeklärt ist und sich zudem um Transparenz bemüht wird, kann sich die ein oder andere Perspektive manchmal sehr verengen und eben auch Unbeholfenheit zur Folge haben.

Manfred Evertz
Zum Glück aber ist jede Beziehung anders. Da auch Therapeuten nur Menschen sind, verhalten sie sich eben auch wie solche, und zwar jeder anders. Das gilt gleichermaßen für die Patienten. Wie sich eine Bindung im therapeutischen Rahmen gestaltet, ist also auch in Anbetracht aller gängigen Lehrmeinungen stets ganz individuell. Ebenso ist es mit dem Abschied. Zu wünschen ist es folglich, dass beide Seiten dies stets bedenken, Therapeuten also achtsam und aufrichtig mit ihren Grenzen umgehen sowie mit dem, was ihnen begegnet, und Hilfesuchende sich niemals ihre Zuversicht nehmen lassen.
Zitat aus „Siddhartha“ von Hermann Hesse: „Anders sah er jetzt die Menschen an als früher, weniger klug, weniger stolz, dafür wärmer, dafür neugieriger, beteiligter.“
PS: Auf der Seite aerzteblatt.de finden Sie einen Artikel mit dem Titel Patientenbeschwerden in der Psychotherapie: Sie werden ernst genommen, der im März 2013 erschienen ist. Erläutert wird hierin das strukturierte Beschwerdemanagement am Beispiel der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen.
Literaturhinweis:
- Bordin, Edward S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 16, 252–260.