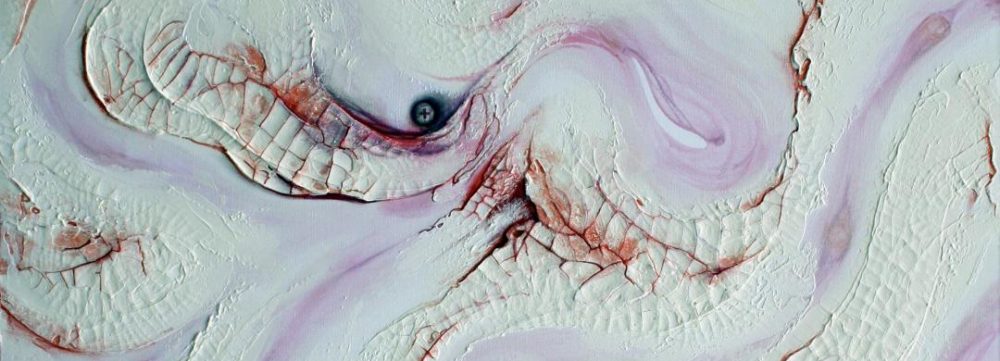„Egal, was Therapeut und Patient miteinander anstellen, die Therapie ist erfolgreich, wenn sich beide wertschätzen.“ (Spitzer 2003) – Dann wäre es ja einfach, ein guter und erfolgreicher Psychotherapeut zu werden, ein akademisch-wissenschaftliches Studium und eine Psychotherapieausbildung wären sogar überflüssig.
Man stelle sich jedoch Folgendes vor: Der Psychotherapeut vermittelt Wertschätzung, Empathie, Wärme und Anteilnahme, aber er ist ungepflegt, das Zimmer ist in einem ungelüfteten und chaotischen Zustand, er weist Körper- und Mundgeruch auf, er versäumt Termine, vergisst wichtige Informationen oder nimmt Eigendokumentationen des Patienten nicht zur Kenntnis, raucht während der Sitzung, die Tür ist nicht geschlossen. Auch wenn man von diesem postmodernen Waldschratmodell eines Psychotherapeuten absieht und nur ein oder zwei seiner Merkmale erwartungswidrig sind, wird der Patient momentan in einen mentalen Zustand versetzt, in dem Wertschätzung, Empathie etc. möglicherweise nicht mehr wirken.
Nur in Einzelfällen können Abweichungen des Psychotherapeuten vom äußeren Habitus und Paradoxien in der Intervention zu einer Verblüffung und „Erfolg versprechenden Verstörung“ i. S. eines Weckrufs führen, wobei die Erwartungswidrigkeit ein Innehalten bewirken kann und vielleicht einen Neustart weg von eingefahrenen Kommunikationsmustern ermöglicht.

Bild: Manfred Evertz
Es stellt sich im Rahmen unseres Themas auch ein methodisches Problem, das die Vergleichbarkeit von Studien einschränkt: Wer schätzt die Güte bzw. Qualität der Allianz ein – der Psychotherapeut, der Patient oder ein unabhängiger Untersucher? Besonders komplex wird es bei multiplen Beurteilungen im Rahmen von Gruppentherapie. Und wie werden Therapieerfolg bzw. Stagnation oder Misserfolg gemessen – mittels Symptomreduktion, Verbesserung der Selbstwertschätzung, Verringerung der Symptomlast, Zunahme an Lebenszufriedenheit, Reduktion der Arbeitsunfähigkeitstage, Stabilität des Therapieerfolgs über Zeit hinweg, Anzahl der benötigten Therapiesitzungen etc.? Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche Haltungen, Verhaltensweisen und Interventionsformen über Empathie und Wertschätzung hinaus die Güte der Allianz ausmachen. Interagiert die Güte oder Qualität der therapeutischen Allianz mit anderen Prädiktoren für den Therapieerfolg?
Studienlage in Auszügen
Nach Lambert (1992) beruhen 30 % des Therapieerfolgs auf der therapeutischen Allianz und nur 15 % auf der spezifischen Technik. Norcross und Wampold (2011) betonen die Bedeutung der therapeutischen Allianz in all ihren Aspekten für den Therapieerfolg, wozu auf Seiten des Therapeuten v.a. Empathie gehöre. Eine Metaanalyse der Studien über die Erfolgswirkung der Allianz liefert zwar eine mittlere Effektstärke von 0.57, dies lässt aber offen, in welchem Ausmaß die Allianzgüte mit der Behandlungskompetenz kovariiert bzw. davon abhängt (Horvath et al. 2011). Im Handbuch von Lambert (2013) werden ausführlich alle Einflussfaktoren für den Therapieerfolg dargestellt und diskutiert. In der umfangreichen Literatur zu diesem Thema ist es verwirrend, dass einige Autoren die Allianzgüte und die Therapeutenkompetenz unter „Therapeuteneffekt“ zusammenfassen, während andere (z.B. Wampold 2015) die therapeutische Allianz unter „gemeinsame Faktoren“ der verschiedenen Methoden subsummieren. Löffler et al. (2014) fanden in einer naturalistischen Studie, dass die Allianzgüte (in Patienteneinschätzung) eine signifikante Moderatorvariable für den erfolgreichen Einsatz von Techniken der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) bei der Depressionsbehandlung darstellt. Demnach ist die KVT umso besser, je mehr Therapeutenkompetenz zur Herstellung einer tragfähigen Allianz einschl. eines Arbeitsbündnisses vorhanden ist, was wiederum auch durch Patientenmerkmale wie deren Bindungsstil beeinflusst ist.
Sicher passen die folgenden Überlegungen und Vorschläge nicht so ganz in die gegenwärtige Wissenschaftslandschaft und sind provokativ. Die gesamte Fragestellung hat einen hohen Komplexitätsgrad. Eine Matrix unabhängiger (Psychotherapeut und Methode) und abhängiger Faktoren (Patient) würde sehr umfangreich ausfallen und keineswegs nur diese beiden Dimensionen umfassen. Dann stellt sich die Frage, was macht weitere Dimensionen aus? Handelt es sich um demografische soziokulturelle Faktoren oder um sogenannte Kontextfaktoren wie Geschlecht (s. Kap. 17.2), um Alter, Passung von Werthaltungen (Rosenthal 1955), Passung des Störungsmodells, Einbezug von Bezugspersonen, Einzel- versus Gruppentherapie, kompakte oder kontinuierliche Interventionsverteilung? Zu diesen Dimensionen gehört aber auch das Basisverhalten des Patienten wie z. B. Verlässlichkeit, soziale Verträglichkeit, Offenheit, Ausdauer, Veränderungsbereitschaft und aktive Anstrengungsbereitschaft.
Bei der Heranziehung von Daten aus dem deutschsprachigen Raum (Lohmann u. Mittag 1979) fällt auf, dass diejenigen Psychoanalytiker als besonders positiv vom Patienten eingeschätzt werden, die als empathisch erlebt werden. Diejenigen Gesprächspsychotherapeuten werden als besonders positiv eingeschätzt, die ab und zu auch einen Ratschlag gaben.
Freud wurde von seinen Schülern und Analysanden keineswegs als so beziehungsabstinent eingeschätzt, wie er es theoretisch vorgab, sondern vielmehr als anteilnehmend und empathisch. Wird damit die anfangs zitierte Bedeutung der Wertschätzung von Spitzer gestützt? Die gesamte gesprächspsychotherapeutische Forschung hat immer wieder die Bedeutung von Empathie, unbedingter Wertschätzung und Echtheit aufseiten des Therapeuten herausgestellt. Wir vermuten, dass auf „Echtheit“ des Psychotherapeuten nicht nur aus seiner verbalen Zuwendung geschlossen wird, sondern auch aus der Konkordanz von nonverbalen Botschaften und verbal geäußertem Inhalt. Placebo-Studien zeigen nämlich, dass der unzweideutig ausgestrahlte Optimismus entscheidend ist für die Bildung von Besserungserwartung, wobei Letztere der allgemeinste Prädiktor für Therapieerfolg aufseiten des Patienten zu sein scheint. Wir nehmen an, dass ein wesentlicher Aspekt der Resonanzfähigkeit des Psychotherapeuten darin besteht, dass er Mimik, Gestik, Stimmführung zu „deuten“ vermag sowie Diskordanzen zwischen den verbalen Äußerungen des Patienten einerseits und seinen nonverbalen Äußerungen andererseits richtig „deutet“ und in seinen Interventionen nutzt.
Klagen von Patienten über Psychotherapeuten (Mohr 1995) beziehen sich auf Distanziertheit, Empathiemangel und Ungeduld. Dies gilt unabhängig von der Therapierichtung. Auch Heim (2009) weist auf die Bedeutung der Dichotomie „freundlich versus unfreundlich“ hin. Er erwähnt aber auch die Dichotomie „dominant versus submissiv“ aufseiten des Psychotherapeuten; beide dieser Extremvarianten sind nicht hilfreich. Darüber hinaus gilt es auf möglichst ausgeglichene Redeanteile zu achten (Ausnahmen: Hypnose und Hypnotherapie).
Zusammenfassend weisen die Studien auf die Bedeutung der emotional-sozialen Kompetenz und Intelligenz des Psychotherapeuten hin. Schon 1961(!) wurde in einer Broschüre der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung über den Beruf des Psychotherapeuten auf folgende Voraussetzungen hingewiesen: natürliche Anlagen, Erwerb erlernbaren Wissens und erlernbarer Fähigkeiten (sic!), verstehende Güte und lebendiges Einfühlungsvermögen.
Zeichnet dieses zwischenmenschliche Geschick die Psychotherapeuten bereits vor ihrer Ausbildung aus und lässt es sich durch die Ausbildung verbessern? Emotional-soziale Intelligenz wird schließlich auch von Nicht-Professionellen erworben, z. B. durch Modelllernen, Übung, Rückmeldung und Reflexion (Lambert 2013). Umso mehr sollten diese übenden Aspekte in der Aus- und Weiterbildung systematische Berücksichtigung finden. Interessanterweise werden von Psychotherapeuten, die selbst Psychotherapie in Anspruch nehmen, nicht nur Wärme, Offenheit und Fürsorge geschätzt, sondern auch Berufserfahrung und -kompetenz (Norcross et al. 2009). […]
Zusammenfassung und Ausblick
Die therapeutische Allianz ist kein isolierter Faktor im Sinne von Orthogonalität. Es bestehen diverse Interkorrelationen zwischen Kontextmerkmalen einschließlich des Einflusses von relevanten Bezugspersonen, Patientenmerkmalen einschließlich der Art und des Ausprägungsgrades der Störung, der Veränderungsmotivation des Patienten und seines Beziehungsstils. Hinzu kommen folgende Therapeutenmerkmale: grundlegende emotional-soziale Intelligenz, Empathie in der Gestaltung der Allianz, die Beachtung formaler Regeln, Störungs- und Interventionswissen und vor allem aber Anwendungsfertigkeiten und -sicherheit im Rahmen fachlich-methodischer Behandlungskompetenz. Alles zusammen macht die Güte der therapeutischen Allianz aus und fördert den Therapieerfolg. Die bloße „kognitive“ Kenntnis der therapeutischen Handlungsregeln (Grawe 1999) reicht u. E. nicht aus, wenn nicht die Umsetzung der Regeln trainiert wird und Umsetzungskompetenz erworben wird. Hier klafft in der Aus- bzw. Weiterbildung eine zu schließende Lücke zwischen Wissen und Können. Es ist weder die Anwesenheit von Supervisoren bei Therapien von Ausbildungsteilnehmern vorgesehen noch die Anwesenheit von Teilnehmern bei Therapie von Supervisoren. Bisher geschieht Supervision nach vier Sitzungen stets verzögert und konterkariert das Wissen über die Wirksamkeit unmittelbarer Rückmeldung. […]
Das Training von Anwendungsfertigkeiten bzw. von Behandlungskompetenz halten wir im Rahmen der geplanten „Direktausbildung“ an Universitäten und Kliniken für gefährdet, und zwar sowohl wegen der geringen Erfahrung von Hochschullehrern in der praktischen Anwendung von Psychotherapie als auch wegen des Verzichts auf die Supervisions- und Selbsterfahrungsexpertise von in der Versorgungsrealität tätigen Psychotherapeuten während der Ausbildungsphase, die zur Approbation führen soll. Denn Psychotherapie ist nicht nur eine Wissenschaft, sondern bei deren Anwendung in der Versorgungsrealität auch eine Kunst (Sulz 2014, 2015). Dies gilt trotz der Unterschiedlichkeit in den Konzeptualisierungen der therapeutischen Allianz zwischen den Psychotherapierichtungen, wie sie in Bronisch und Sulz (2015) dargestellt werden.
Auf diesen Erkenntnissen, Überzeugungen und eigenen Erfahrungen aufbauend begrüßen wir einen Brückenschlag zwischen Behandlungsmethoden. Dieser integrative Ansatz wird auch von ehemals rein kognitiven Verhaltenstherapeuten favorisiert, welche die eher aus psychodynamischen und humanistischen Verfahren stammende Einbeziehung von frühen sozialen Erfahrungen und Prägungen (Bindungserfahrungen) nahelegen. Außerdem wird ein Eingehen auf die Vermeidung von emotionalem und somatischem Erleben sowie die Einbeziehung des Erlebens der gegenwärtigen therapeutischen Allianz empfohlen (Borkovec 2005; Newman et al. 2004). Wir schlagen daher eine maßgeschneiderte und Ressourcen berücksichtigende Psychotherapie mit Individuum bezogener „Feinsteuerung“ (Dick et al. 1999) vor, und zwar über Richtlinienverfahren hinaus. Die große Mehrzahl stationär und ambulant tätiger Psychotherapeuten behandelt trotz ihrer verfahrensspezifischen Ausbildung übrigens längst im Sinne einer integrativen Psychotherapie (s. Kap. 12). Systematisierte eklektische Ansätze sind bereits von Wachtel (1977), Beutler (1983) und von Orlinsky und Howard (1987) vorgelegt worden. Heim (2ooo) hat den Versuch unternommen, solche Modelle einem Ausbildungskonzept zu Grunde zu legen. Lazarus (1989) hatte sich mit seine Multimodalen Therapie von der klassischen Verhaltenstherapie zu Gunsten eines technischen Eklektizismus` entfernt. All diese seit langer Zeit bekannten Ansätze entsprechen im Kern unserer hier dargelegten Auffassung von einer Individuum bezogenen Maßschneiderung.
Seit Jahren mehren sich die Veröffentlichungen über Glück und Glücklichsein (z.B. Bormans 2011) und über Freude als Haltung dem Leben gegenüber i.S. einer spirituellen Lebensphilosophie (Dalai Lama und Tutu 2016). Diese Ansätze der Philosophischen Psychologie sind oft überlappend mit solchen der Positiven Psychologie (Seligman 2012). Tugenden, Resilienz- und Salutogenesefaktoren sind daraus zu entnehmen wie: Akzeptanz, Weisheit, Neugier, Echtheit, Tapferkeit, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Selbstdistanzierung, Besonnenheit, Dankbarkeit, Vergebung, Transzendenz, Humor, Sinnorientierung und -erleben. Insbesondere im Sinnerleben besteht eine Nähe zum Kohärenzkonzept von Antonovsky (1997). Was das nun für Psychotherapeuten und deren Allianz- und Interventionsgestaltung bedeutet, das mag jeder für sich entscheiden. Aber welchen Wert hat eine Haltung ohne entsprechendes Verhalten, denn: „Um die Menschen kennen zu lernen, muss man sie handeln sehen“ (J. J. Rousseau).
PS: In dem Buchartikel finden sich 43 Hinweise für die Ausbildung von Umsetzungs- und Behandlungskompetenz.
Dr. Hans-Jörg Lütgerhorst war 35 Jahre in psychiatrischen und psychotherapeutischen Kliniken in Vollzeit tätig, seit 2010 in ambulanter Praxis. Er verfügt über eine Approbation und zertifizierte über Aus- bzw. Weiterbildungen in Verhaltenstherapie und Kognitiver VT, Gesprächspsychotherapie und Focusing-Therapie sowie Hypnosetherapie. Er wurde 1993 von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung als Supervisor für Einzel- und Gruppen-VT anerkannt und ist akkreditierter Dozent, Supervisor, Selbsterfahrungsleiter und Approbationsprüfer an den Landesprüfungsämtern NRW u. RPL. Er unterrichtet in Südafrika sowie an 10 staatlich zugelassenen Aus- und Weiterbildungsinstituten im Bundesgebiet und hat 6 Fachartikel veröffentlicht. Weitere Informationen zum Werdegang finden Sie hier: Curriculum Vitae 2020. E-Mail: hans-joerg@luetgerhorst.de
Quelle:
Bei diesem Text handelt es sich um Auszüge aus dem 9. Kapitel des folgenden Buches:
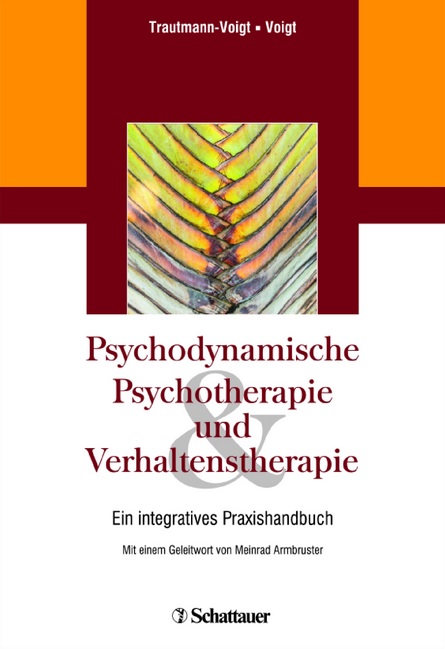
- Sabine Trautmann-Voigt & Bernd Voigt (Hrsg.) (2017). Psychodynamische Psychotherapie und Verhaltenstherapie: Ein integratives Praxishandbuch. Klett-Cotta / Schattauer.