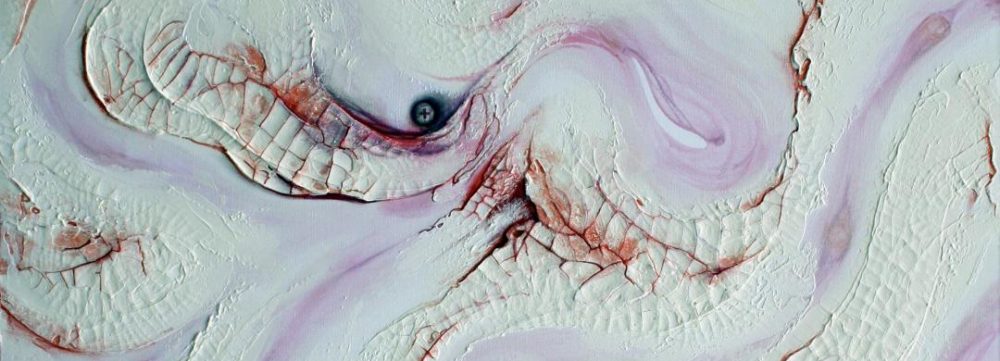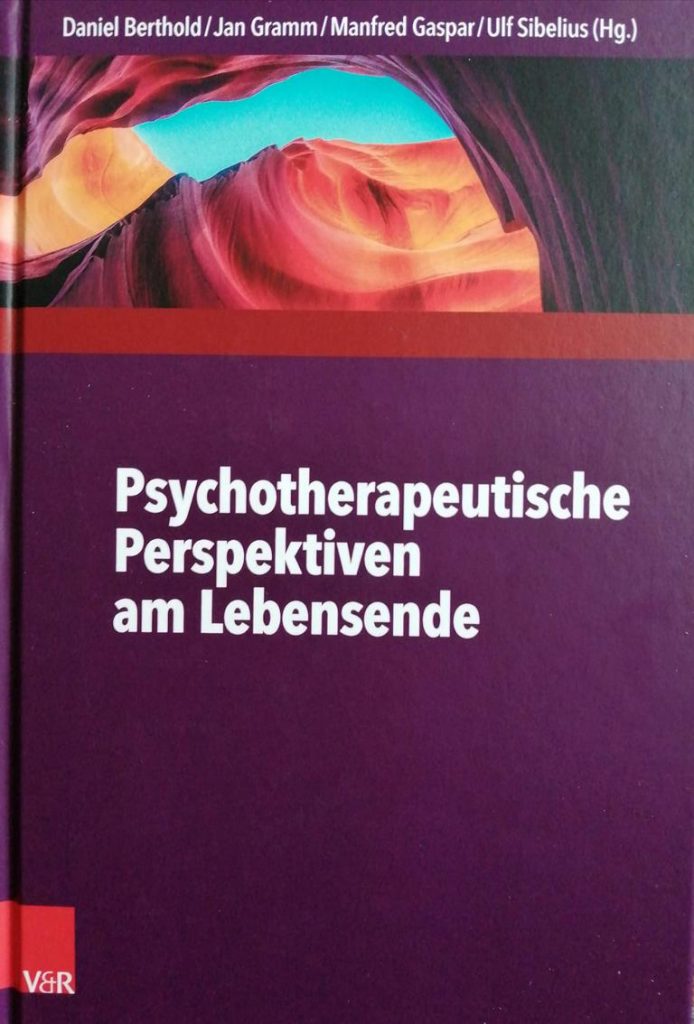Es gibt Probleme, die sich nicht – zumindest nicht im klassischen Sinne – lösen lassen. Wie fühlt es sich an, an einer unheilbaren Krankheit zu leiden? Was macht es mit Menschen, wenn sie ihren eigenen Tod vor Augen haben? Wie kann man ihnen helfen? Kann man das überhaupt? Und was ist mit jenen, die ihnen nahestehen?
Vor Kurzem wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, für ein paar Stunden pro Woche auf einer Palliativstation in einem Krankenhaus zu arbeiten? Da ich zunächst nur eine relativ vage Vorstellung davon hatte, was mich dort erwarten würde, überlegte ich mir, was ich in meiner Funktion als Psychologe denn eigentlich ganz konkret für die Patienten/-innen und ihre Angehörigen im Rahmen einer Palliativbehandlung tun könne? Was wären meine Aufgaben? Wie genau arbeitet man dort? Welches spezifische Wissen könnte mir dabei nützen bzw. von mir erwartet werden? Also suchte ich zunächst nach entsprechenden Informationen im Internet und legte mir einen Ordner an, in den ich sämtliche Dokumente einfügte, die ich finden konnte, und schaute sie mir über die Weihnachtsfeiertage genauer an. So lernte ich zum Beispiel, was es mit der Dignity-Therapie auf sich hat und vieles mehr. Obwohl diese Materialsammlung schon recht umfangreich war, blieben etliche Fragen offen. Deshalb habe ich mich sehr darüber gefreut, als Prof. Dr. Jürgen Kriz mich auf dieses Buch aufmerksam machte, für das er selbst einen Artikel über die Anwendungsmöglichkeiten der Personzentrierten Systemtheorie geschrieben hatte, den er mir zukommen ließ. Da ich mich kurz zuvor mit seinem Modell intensiver beschäftigt hatte und mir klar war, dass in der Palliativpsychologie systemisch gearbeitet wird bzw. werden sollte, wurde ich nun neugierig und wollte erfahren, welche Ansätze und Ideen es sonst noch so gibt?
Zu Beginn dieses Buches wird etwas über die Situation der Palliativ- und Hospitzversorgung in Deutschland sowie über zukünftige Herausforderungen berichtet und auf die Rolle der Psychologen/-innen eingangen, die dort tätig sind. Daraufhin werden eine Vielzahl fundierter Antworten auf die Frage angeboten, wie man als Psychologe/-in Menschen, die aufgrund einer unheilbaren Erkrankung kurz vor dem Ende ihres Lebens stehen, und deren Angehörige (therapeutisch) begleiten könne? Worauf sollte man dabei achten? Welche Vorgehensweisen oder Methoden haben sich in der Praxis bewährt? Dafür haben zahlreiche namhafte Autoren/-innen ihr Wissen aus den sich – zum Teil grundlegend (d. h. hinsichtlich des Menschenbildes, charakteristischer Modellannahmen, der Behandlungsmethoden etc.) voneinander unterscheidenden – psychotherapeutischen Perspektiven bzw. Schulen sowie die damit gemachten Erfahrungen zusammengetragen.
Eigentlich wollte ich mir zunächst lediglich die (vermeintlichen) Rosinen herauspicken, also die Artikel jener Autoren/-innen lesen, die sich der Thematik aus der Perspektive eines mir vertrauten oder wenigstens hinreichend gut bekannten therapeutischen Ansatzes zuwenden. Dazu gehören bspw. die Verhaltenstherapie, die Gestalttherapie oder das Zürcher Ressourcen Modell. Davon bin ich allerdings bereits nach dem ersten Artikel abgekommen, denn auch die darauffolgenden Beiträge, die aus Richtungen kamen, mit denen ich mich bislang nicht so intensiv beschäftigt hatte (z. B. die Perspektiven der Analytischen Psychologie, der Körperzentrierten Psychotherapie oder der Psycholytischen Therapie) waren nicht weniger interessant.
Eine seichte Lektüre war es jedoch nicht, was ich ja allein aufgrund des Titels schon hätte vermuten können. Immer wieder musste ich nämlich beim Lesen an jene Zeit zurückdenken, in der ich damit konfrontiert wurde, eine schwerwiegende Entzündung im Gehirn zu haben, bei der den Ärzten zunächst völlig unklar war, woher sie kam und wie sie behandelt werden könne. Begleitet wurde sie von einem Schlaganfall, der mich überhaupt erst zu einem Arzt und daraufhin ins Krankenhaus führte. Der Radiologe, der mich zuerst darüber informierte, sagte mir aufrichtig, ich hätte – vielleicht auch trotz einer sofortigen Behandlung – eventuell nur noch wenige Wochen zu leben. Nach einer relativ kurzen Phase der Verwirrung, in der ich kaum noch klar denken konnte, folgte eine längere Episode, in der ich mich vollkommen zurückzog, also nicht besucht werden und am Telefon mit niemandem sprechen wollte, da ich damit beschäftigt war, mich mit meiner eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Die Sache ging zwar gut aus, sie hat allerdings etwas mit mir gemacht, das ich damals kaum in Worte fassen konnte. Mir stellte sich die Frage, wie ich mein bisheriges Leben geführt hatte und ob ich damit eigentlich zufrieden sein könne? Ich war es nicht und musste nun sozusagen im Handumdrehen meinen Frieden damit schließen und akzeptieren, dass alles Geschehene geschehen ist und ich vielleicht kaum noch die Möglichkeit habe, etwas daran zu ändern oder es wiedergutzumachen. Wie viele Menschen habe ich wissentlich oder versehentlich verletzt? Wie oft ist mir selbst Unrecht widerfahren? Habe ich die Fülle meines Lebens ausgeschöpft und etwas daraus gemacht, auf das ich eventuell stolz oder mit dem ich zumindest im Reinen sein kann? Habe ich die mir zur Verfügung stehende Zeit auf dieser Welt hinreichend wertgeschätzt?
Natürlich ist mir bewusst, dass jede Auseinandersetzung mit dem Sterben, dem Tod und der eigenen Vergänglichkeit eine ganz individuelle Angelegenheit ist, und meine Erfahrungen sich wohl kaum 1:1 mit denen vergleichen lassen, die andere Menschen in einer ähnlichen Situation machen. Dennoch denke ich, dass diese Erfahrung wertvoll war und sie mir nun sogar dabei hilft, mich in meine neue Aufgabe einzufinden. Jedenfalls habe ich mich selbst in vielen Stellen dieses Buches wiedererkannt: meine Ängste vor dem Ungewissen, meine Unsicherheit, wie ich in meinem Umfeld darüber sprechen sollte, die Erinnerungen an schöne sowie missglückte Beziehungen, die (Abschluss-)Bilanzierung meines Lebens etc. Es hat mir ausgesprochen gut gefallen, wie einfühlsam und zugleich konstruktiv die Autorinnen und Autoren sich den verschiedenen Aspekten angenommen haben. Immer wieder habe ich das Buch für eine Weile zur Seite legen müssen, um das Gelesene zu verarbeiten. Oft habe ich dann auch an jene Menschen gedacht, die mir nahestanden und die bereits „gegangen“ sind. Das war anstrengend, emotional aufwühlend, aber auf seltsame Weise trotzdem wohltuend.
Auch habe ich fachlich sehr viel gelernt! Vor allem die zahlreichen Kurzinterventionen, die so wunderbar erläutert werden, dass sie unmittelbar anwendbar sind, fand ich äußerst hilfreich! Die Artikel sind allesamt gut zu verstehen, selbst dann, wenn man über die jeweiligen Therapieverfahren noch nicht allzu viel weiß. Ich kann dieses Buch also sehr empfehlen! Mich hat es jedenfalls begeistert!
- Daniel Berthold, Jan Gramm, Manfred Gaspar & Ulf Sibelius (Hrsg.). Psychotherapeutische Perspektiven am Lebensende. Vandenhoeck & Ruprecht (2017).
- Hier finden Sie das Buch auf der Produktseite des Verlags.