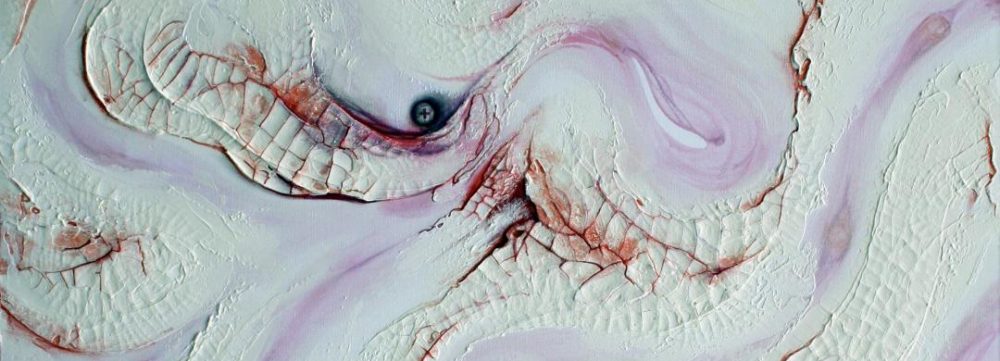Was kann man als Führungskraft tun, wenn Mitarbeiter plötzlich stark verändert wirken, verhaltensauffällig werden oder ganz offensichtlich psychisch erkrankt sind? Wie spricht man das an?
Über psychische Erkrankungen, die laut diverser Statistiken einen beachtlichen Anteil der Krankmeldungen und zahlreiche Frühverrentungen bedingen, wird in den Medien bereits seit einigen Jahren umfassend berichtet. Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass sich die numerische Zunahme der F-Diagnosen dadurch erklären lässt, dass sowohl die diagnostische Kompetenz der Ärzte in diesem Bereich wie auch die Bereitschaft der Betroffenen, entsprechende Symptome anzuerkennen und sich Hilfe zu suchen, in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben, wird seither in den Unternehmen verstärkt diskutiert, wie man mit dieser Entwicklung umgehen sollte.
Die Arbeit ist natürlich nicht der einzige Grund, warum so viele Menschen psychisch erkranken, zumal immer auch individuelle Faktoren (wie z. B. die Resilienz) maßgeblich dafür sind, wie gut bspw. der Umgang mit beruflichen Belastungen gelingt, dennoch kommt man nicht umhin, sich mit ihren Rahmenbedingungen zu befassen. Mit Gefährdungsbeurteilungen, die auch psychische Belastungsfaktoren erfassen, und einem betrieblichen Gesundheitsmanagement wird sich in vielen Unternehmen redlich darum bemüht, diese dramatische Entwicklung zu stoppen. Auch Führungskräfte sind im zunehmenden Maße sensibilisiert und werden verstärkt darin geschult, auf die psychischen Problemen ihrer Mitarbeiter einzugehen. Gewisse Berührungsängste sind hierbei allerdings gang und gäbe.
Bei körperlichen Beschwerden sind die meisten Menschen schnell bereit, zum Arzt zu gehen und darüber zu sprechen. Anders ist es z. B. bei Ängsten oder Depressionen. Dabei ist es auch bei psychischen Problemen durchaus sinnvoll, zügig zu handeln und sich gegebenenfalls professionell helfen zu lassen. Oftmals sind es bereits kleine Veränderungen im privaten oder beruflichen Bereich oder der inneren Einstellung, die die Betroffenen vor einer schwerwiegenderen Erkrankung bewahren können. Denkt man aber als Führungskraft oder Unternehmer daran, dass die eigenen Mitarbeiter psychische Störungen entwickeln könnten, entsteht leicht ein Gefühl der Verunsicherung und Hilflosigkeit. Verbunden damit sind nämlich oftmals lange Ausfallzeiten, die in der Regel zu einer Mehrbelastung der verbleibenden Kollegen führen, sowie ggf. ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Schaden.

Manfred Evertz
Die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter, für die man verantwortlich ist, irgendwann einmal betroffen sein könnten, ist relativ hoch. Dennoch scheuen sich viele Führungskräfte scheinbar davor, das Thema aktiv anzugehen und im Zweifelsfall ein Gespräch anzubieten. Eventuell könnte ja plötzlich die Frage aufgeworfen werden, ob sie selbst etwas falsch gemacht haben? Zudem fällt es wohl nicht immer leicht, einen Menschen, mit denen man ja eigentlich “nur” zusammenarbeitet, auf persönliche Themen anzusprechen. Aber auch viele Betroffene halten sich am Arbeitsplatz bedeckt, da sie Angst davor haben, sich durch einen offenen Umgang mit ihren psychischen Problemen ins berufliche Abseits zu manövrieren. Möchte man also den Krankenstand in einem Unternehmen senken, macht es m. E. Sinn, einen Rahmen zu schaffen, in dem auch persönliche Themen besprochen werden können. Dafür gibt es in der betrieblichen Gesundheitsförderung inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, wie z. B. das Angebot einer Psychologischen Beratung, die m. E. anonym und niedrigschwellig zugänglich sein sollte. Anbieten würde sich dafür entweder ein Employee Assistance Program oder der Einsatz eines/-r Betriebspsychologen/-in mit regelmäßigen “Sprechstunden”.
Trotzdem sind Führungskräfte – im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht – aufgefordert, Probleme frühzeitig offen zu kommunizieren, Auffälligkeiten, die auf psychische Erkrankungen hindeuten könnten, anzusprechen, dabei ihre Erwartungen klar zu formulieren und ggf. Unterstützung anzubieten. Das Prinzip des „Förderns und Forderns“ sowie die stetige Überprüfung, ob bzw. inwieweit Arbeitsanforderungen und Leistungsvermögen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, sind dabei von großer Bedeutung. Der Führungskraft nun aber abzuverlangen, therapeutisch zu intervenieren, ist allerdings falsch. Das gehört schließlich nicht zu ihren Aufgaben! Sind die Symptome einer psychischen Erkrankung bereits stark ausgeprägt bzw. offensichtlich, ist deshalb eine Psychotherapie zu empfehlen. Andernfalls helfen auch übertriebene Schonung oder Fürsorge nicht – weder dem Mitarbeiter noch dem Unternehmen.
In Seminaren werde ich oft danach gefragt, anhand welcher Symptome man eine bzw. welche psychische Störung feststellen könne. Dabei scheint man davon auszugehen, dass sich mit dem erworbenen Wissen über entsprechende Krankheitsbilder so manche Verhaltensauffälligkeit besser erkennen und ein damit verbundenes Problem leichter aus der Welt schaffen lässt. Aber dieses „Wissen“ kann dazu verleiten, Menschen in eine Schublade zu packen und ihnen mit einer herablassend wirkenden Haltung zu begegnen, die leicht den Eindruck erweckt, als würde man für sich beanspruchen, in den anderen hineinsehen zu können. Gegen diese Art der Deutungshoheit wehrten sich berühmte Psychotherapeuten schon in den 1950er und 1960er Jahren. Ihrer Ansicht nach besteht (sogar) die Aufgabe eines Therapeuten vor allem darin, Hilfestellungen verschiedenster Art zu geben, um Klienten dabei zu unterstützen, selbst einen Weg zu finden, sich aus ihren Verstrickungen zu befreien und die damit verbundenen Probleme eigenständig zu lösen. Die Diagnose psychischer Störungsbilder war für sie deshalb eher nebensächlich.
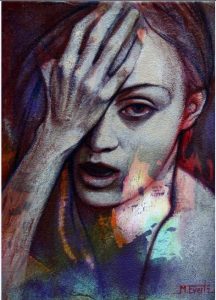
Manfred Evertz
Eine Diagnose birgt zudem die Gefahr, dass man sich als Betroffener (zu sehr) mit ihr identifiziert und sein eigenes Verhalten dann mit dieser rechtfertigt. „Weil ich eine Depression habe, bin ich eben schlecht gelaunt. Da ich eine Angststörung habe, gehe ich bestimmten Situationen aus dem Weg. Weil ich dies oder das habe, verhalte ich mich auf eine entsprechende Art und Weise. Letztendlich bin ich also nicht schuld daran bzw. nicht verantwortlich für das, was ich tue oder nicht tun kann.“
Trotzdem ist es aber wichtig, achtsam zu sein bzw. genau hinzusehen, Veränderungen wahrzunehmen (auf vier Ebenen: Veränderungen im Leistungs- oder Sozialverhalten, der Stimmung oder bei maßgeblichen Auffälligkeiten des äußeren Erscheinungsbildes) und den betreffenden Mitarbeiter auf diese Beobachtungen anzusprechen sowie ggf. konkrete Hilfe anzubieten. Die Befürchtung, sich dabei falsch oder grenzüberschreitend zu verhalten, ist allerdings noch immer recht verbreitet. Kommt man also an die eigenen Grenzen, ist es sinnvoll, auf ausgebildete Fachleute hinzuweisen bzw. diese zu Rate zu ziehen. Meistens hilft es aber bereits, mit den Mitarbeitern über das auffällige Verhalten zu sprechen und mittels gezielter Fragen gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Dies setzt allerdings ein gewisses Vertrauen voraus. Ist das nicht gegeben bzw. das vorherrschende Klima wenig geeignet, um ein solches Gespräch zu führen, kann es für das Unternehmen schnell teuer werden. Dann stellt sich aber die Frage, welcher Betrieb sich eine solche Führungskraft tatsächlich leisten möchte?
Doch wie führt man nun ein solches Gespräch? Vor einiger Zeit hatte die Barmer GEK zusammen mit dem Dachverband Gemeindepsychiatrie e. V. ein pdf-Dokument mit dem Titel „Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz – Eine Handlungsleitlinie für Führungskräfte“ herausgebracht, in dem sehr gute Tipps zur Gesprächsführung zu finden waren. Leider ist das betreffende pdf-Dokument online zurzeit nicht verfügbar. Die darin vorgestellte Vorgehensweise bzw. die Abfolge der einzelnen Schritte, die ich im Folgenden zusammengefasst habe, halte ich jedenfalls für eine wunderbare Heuristik. Vielleicht finden Sie darin ja auch den ein oder anderen Aspekt, der Ihnen nützlich erscheint?
Gesprächsleitfaden für Führungskräfte
I. Eröffnungsphase
→ Anlass nennen:
- Sprechen Sie kurz an, dass Sie Veränderungen wahrgenommen haben, die Sie beunruhigen. Beschreiben Sie diese Veränderungen jetzt aber noch nicht.
→ Ziele nennen:
- Sie möchten Ihrer Fürsorgepflicht nachkommen, weil Sie sich Sorgen um die Gesundheit des Mitarbeiters machen.
- Sie wollen klären, ob die Veränderungen mit Belastungen oder Problemsituationen im betrieblichen Alltag zusammenhängen. Sollte dies der Fall sein, geht es darum, gemeinsam eine Lösung zu finden und die Belastungen abzustellen oder zu minimieren.
II. Dialogphase der Klärung
→ Beschreibung:
- Sie beschreiben sachlich die Veränderungen, die Ihnen persönlich aufgefallen sind.
- Dabei vermeiden Sie jede Interpretation oder Vermutung.
- Zeigen Sie ggf. auf, welche Konsequenzen das veränderte Verhalten für den betrieblichen Alltag hat.
→ Offene Fragen zur Selbstwahrnehmung, zu den Ursachen und Hintergründen:
- Wie erleben Sie die Veränderung?
- Gibt es Veränderungen in Ihrem Verhalten, die Ihnen selbst aufgefallen sind?
- Was mag aus Ihrer Sicht dazu beigetragen haben, dass ich eine Veränderung Ihres Verhaltens wahrgenommen habe?
- Womit könnten die Veränderungen in Zusammenhang stehen?
- Können Sie mir sagen, was die Gründe für diese Veränderungen sein könnten?
III. Phase der Lösungsfindung und Vereinbarungen
a) Eine Verhaltenskorrektur ist (noch) nicht zwingend erforderlich.
→ Ermutigung:
- Wenn keine betrieblichen Bedingungen erkennbar sind, ermutigen Sie den Mitarbeiter zu einem klärenden Gespräch mit einem Haus- oder Facharzt. Veränderungen im Erleben und Verhalten können auch körperliche Ursachen haben. Dies gilt es ggf. möglichst früh zu erkennen, um die Heilungschancen zu verbessern.
- Kommen Probleme aus dem Privatleben des Mitarbeiters zur Sprache, sollten Sie entweder auf entsprechend spezialisierte Beratungsstellen hinweisen und/oder gemeinsam überlegen, wie damit so umgegangen werden kann, dass die Arbeitsqualität (auch künftig) nicht darunter leidet.
→ Problemlösung bei Ursachen im betrieblichen Zusammenhang:
- Was muss sich ändern, damit Sie wieder eine zufriedenstellende Arbeitssituation haben? Was muss getan werden, damit Sie Ihre Arbeit weiterhin gut ausführen können?
- Wie können Anspannungen und Stresssituationen reduziert werden? Wie ließe sich Ihre Arbeitsbelastung verringern? Gibt es organisatorische oder technische Möglichkeiten?
→ Lösungsansätze:
- Erarbeiten Sie praktikable Vorschläge und bieten Sie Hilfestellungen an: Wie kann ich Sie unterstützen? Welche Hilfe können Sie sich von meiner Seite vorstellen?
- Schlagen Sie ggf. Lösungsansätze vor und gleichen diese mit den Vorstellungen des Mitarbeiters ab.
- Vereinbaren Sie konkrete Schritte und Maßnahmen.
b) Eine Verhaltenskorrektur ist erforderlich.
→ Betonung der Zielsetzung:
- Legen Sie präzise fest, welche Korrektur des Verhaltens Sie erwarten.
- Sellen Sie eindeutig dar, welche Verbesserung des Leistungsniveaus Sie bis zu welchem Zeitpunkt erwarten.
→ Offene Fragen zu den Zielen:
- Was können Sie tun, um diese Ziele zu erreichen?
- Womit kann ich Sie unterstützen?
- Welche Hilfe, welche Unterstützung brauchen Sie, um die Ziele zu erreichen?
- Wo sehen Sie die Grenzen Ihrer persönlichen Belastbarkeit?
- Was kann verändert werden, um die Rahmenbedingungen für Sie günstiger zu gestalten?
- Wie können aus Ihrer Sicht belastende Momente abgebaut werden?
- Was hilft Ihnen, in der Situation leistungsfähig zu bleiben?
- Gibt es etwas, das für Sie vereinfacht werden könnte?
- Welchen Beitrag kann das Team bzw. können die Kollegen aus Ihrer Sicht leisten?
- Möchten Sie, dass ich den Kollegen bzw. dem Team etwas Bestimmtes mitteile?
- Welche Probleme müssten gelöst werden, damit es Ihnen besser geht?
- Was kann für den Fall einer Zuspitzung der Krisensituation zwischen uns vereinbart werden?
→ Unterstützung:
- Ermutigen Sie den Mitarbeiter ggf. zu einem klärenden Gespräch mit einem Haus- oder Facharzt oder Psychotherapeuten.
- Bieten Sie dem Mitarbeiter gezielte Hilfestellung an (s. o.).
- Zeigen Sie Konsequenzen auf, wenn die Hilfsangebote nicht angenommen bzw. die vereinbarten Ziele nicht erreicht werden.
- Legen Sie fest, woran Sie einen Fortschritt bemessen und in welcher Form Sie darüber eine Rückmeldung an den Mitarbeiter geben.
- Vereinbaren Sie konkrete Schritte und Maßnahmen.
IV. Gesprächsabschluss
- Vereinbarung eines Folgetermins
- Positiver Ausklang
Quelle:
- Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. & BARMER GEK (2014). Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz – Eine Handlungsleitlinie für Führungskräfte.
Literaturhinweis:
- Nicole Susann Roschker (2013). Psychische Gesundheit als Tabuthema in der Arbeitswelt – Analyse der DAX 30 und Leitfaden für die Unternehmensberichterstattung. Springer Fachmedien.
- Hier finden Sie eine Rezension.