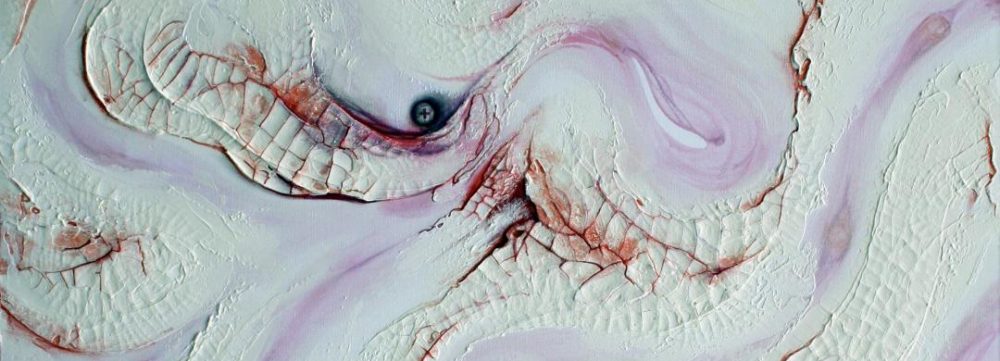Die Suche nach der eigenen Identität ist für viele Menschen ein zentrales Thema – nicht nur in der Pubertät. Doch lässt sie sich überhaupt definieren? Ist nicht jeder Versuch, sich selbst bzw. den Kern der eigenen Persönlichkeit zu beschreiben bzw. zu benennen, nur ein temporäres Konstrukt, das sich aus der momentanen Selbstwahrnehmung ableitet? Verändern wir uns ständig oder gibt es Konstanten in unserem Wesenskern? Lassen sich Individuen tatsächlich in „Persönlichkeitstypen“ kategorisieren, oder basieren derlei Vorstellungen lediglich auf Simplifizierungen? Ist nicht jede (Selbst-)Definition abhängig von der Perspektive, aus der heraus sie konstruiert wird?
Der Persönlichkeitspsychologie hat es noch nie an theoretischen Konstrukten gemangelt: Begriffe wie Motive, Eigenschaften, Werte, Wünsche, Einstellungen, Ziele, Überzeugungen, Schemata und Bedürfnisse sind Beispiele der konzeptionellen Einheiten, die in dem Vorhaben, die menschliche Persönlichkeit zu verstehen, untersucht wurden. In der Persönlichkeitspsychologie, in der es nach Schneewind (1996) um die Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und Veränderung des individuellen Erlebens und Verhaltens geht, herrschte lange Zeit der “Trait”-Ansatz vor, der mit der Entwicklung der sogenannten “Big Five” nochmals Aufwind bekam. Kritik wurde dieser Herangehensweise deswegen entgegengebracht, weil sich Eigenschaften relativ schlecht dazu eigneten, Verhalten vorherzusagen. Asendorpf (1996) weist in diesem Zusammenhang auf Phänomene wie die transsituative Inkonsistenz von Verhalten oder die mangelnde Reaktionskohärenz hin. Ein weiterer Mangel bestehe in der dürftigen Korrelation der Trait-Indikatoren untereinander. Eigenschaften sind also lediglich beschreibende Einheiten, die auf wiederholtem und gewohnheitsmäßigem Handeln beruhen, während Motive gerichtetes Verhalten erklären sollen.
In dem Buch „Identität. Ein Kernthema moderner Psychotherapie – interdisziplinäre Perspektiven“ von Prof. Hilarion G. Petzold wurde ich auf das folgende Zitat (S. 79 f.) aufmerksam:
„Die Frage nach der Identität hat eine universelle und eine kulturell-spezifische Dimensionierung. Es geht bei der Identität eigentlich immer um die Herstellung einer Passung zwischen dem subjektiven „Innen“ und dem gesellschaftlichen „Außen“, also zur Produktion einer individuellen sozialen Verortung. […] Die universelle Notwendigkeit zur individuellen Identitätskonstruktion verweist auf das menschliche Grundbedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Es soll dem anthropologisch als „Mängelwesen“ bestimmbaren Subjekt eine Selbstverortung ermöglichen, liefert eine individuelle Selbstbestimmung, soll den individuellen Bedürfnissen sozial akzeptablere Formen der Befriedigung eröffnen. Identität bildet ein selbstreflexives Scharnier zwischen der inneren und äußeren Welt. Genau in dieser Funktion wird der Doppelcharakter von Identität sichtbar. Sie soll einerseits das unverwechselbare Individuelle, aber auch das soziale Akzeptable darstellbar machen. Insofern stellt sie immer eine Kompromissbildung zwischen „Eigensinn“ und Anpassung dar, insofern ist der Identitätsdiskurs immer auch mit Bedeutungsvarianten von Autonomiebestrebungen (z. B. Nunner-Winkler 1983) und Unterwerfung (so Adorno oder Foucault) assoziiert, aber erst in der dialektischen Verknüpfung von Autonomie bzw. Unterwerfung mit den jeweils verfügbaren Kontexten sozialer Anerkennung entsteht ein konzeptuell ausreichender Rahmen.
Das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Unterwerfung (mir gefällt in diesem Zusammenhang der Begriff „Anpassung“ besser) lässt sich auf verschiedene Bedürfnisse zurückführen, die nicht selten in Konkurrenz zueinander stehen: Ich-Bedürfnisse versus sozialer Bedürfnisse (bspw. nach Zugehörigkeit). Sich die Frage zu stellen, wer oder wie man denn nun sei, mag zwar in bestimmten Kontexten sinnvoll sein, grundsätzlich lässt sich aber wohl kaum eine endgültige Antwort darauf finden. Die Ergebnisse von Persönlichkeitstests könnte man demzufolge also als „vorläufige Bestandsaufnahmen“ betrachten, die sich im Laufe der Jahre (mehr oder weniger) verändern können. Sie bieten lediglich Heuristiken an, die uns dabei helfen, uns Menschen irgendwie voneinander zu unterscheiden. Persönlich bevorzuge ich es deshalb, mich an dem humanistischen Ideal zu orientieren: „Sei Du selbst und werde, der Du bist.“ Übersetzen könnte man dies mit: „Achte auf Deine Bedürfnisse (ansonsten wirst Du Dir selbst fremd) und entwickle Dein Potenzial (also das, was bereits in Dir steckt).“ Gelingen kann das allerdings am ehesten dann, wenn man dabei nicht nur sich selbst, sondern auch sein soziales Umfeld im Blick hat.
Individualität bzw. Identität muss man sich nicht erarbeiten oder „antrainieren“. Sie ist uns bereits von Natur aus mitgegeben. Vergleichen wir uns mit anderen oder versuchen, uns mittels eines Tests besser zu erkennen, kann das zwar zu neuen Einsichten führen, niemals aber zu einem vollständigen Bild unserer Persönlichkeit. Manchmal ist es deshalb vielleicht besser, sich (wenigstens ein Stück weit) davon zu befreien. Man könnte also auch sagen: Wir sind, wer wir sind. Machen wir doch einfach das Beste daraus.
Was denken Sie darüber?
Hier finden Sie Psyche und Arbeit bei Facebook.
Literaturhinweise:
- Asendorpf, J. B. (1996). Psychologie der Persönlichkeit. Berlin: Springer.
- Petzold, Hilarion G. Petzold (Hrsg.) (2012). Identität. Ein Kernthema moderner Psychotherapie – interdisziplinäre Perspektiven. VS Verlag für Sozialwissenschaften – Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Schneewind, K. A. (1996). Persönlichkeitstheorien. Darmstadt: Primus Verlag.