Das folgende Gespräch fand am 16. Mai 2019 in Berlin statt. Anlass war ein Artikel von Professor Schönpflug in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23. März 2019 mit dem Titel „Ist das Ende der Psychologie gekommen?“, den Sie hier nachlesen können.
Ihre Vorlesungen zur Geschichte der Psychologie an der Freien Universität Berlin habe ich in guter Erinnerung. Ihr Lehrbuch „Geschichte und Systematik der Psychologie“ benutze ich immer noch als Nachschlagewerk. Sie haben uns damals in die lange Geschichte der Psychologie eingeführt. Nun haben Sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben, dass das neue Psychotherapeutengesetz das Ende der Psychologie als breitgefächerte und vielseitig anwendbare einheitliche Disziplin einläuten könnte.
W.S.: Erinnern Sie sich noch an das Zitat von Franz Kafka? „Übelkeit nach zu viel Psychologie. Wenn einer gute Beine hat und an die Psychologie herangelassen wird, kann er … in beliebigem Zickzack Strecken zurücklegen wie auf keinem anderen Feld. Da gehen einem die Augen über.“ So habe ich mir das vorgestellt: Je nach Temperament springen oder wandern, jedenfalls mobil sein, auch mal schwindelig werden auf einem weiten Feld, auf dem als Grundlagenfächer Allgemeine Funktionenlehre, Entwicklungs-, Persönlichkeits- und Sozialpsychologie gedeihen, dazu viele Praxisfächer wie Klinische und Pädagogische Psychologie, Wirtschafts-, Gesundheits-, Umwelt- und Rechtspsychologie. Wie sich dieses Ensemble geformt hat, habe ich in der von Ihnen genannten „Geschichte und Systematik“ zu erklären versucht.
Mir hat das viel Spaß gemacht. Aber viele Kommilitonen haben sich von Ihrer Begeisterung nicht anstecken lassen. Sie fragten: Wozu soll ich das lernen? Das bringt mir doch nichts für meinen Beruf!
W.S.: Ja, das hat mir leid getan. Ich schwankte: Sollte ich die Studenten bedauern, weil sie mich als Dozenten und Prüfer ertragen mussten, oder sollte ich mich bedauern, weil ich Studierende unterrichten und prüfen musste, die an meiner Lehre kein Interesse hatten.
Das ging ja nicht nur Ihnen mit Ihrer Allgemeinen Psychologie so. Unter der Methodenlehre haben noch viel mehr gestöhnt. Wozu Forschungsmethoden? Das spielt doch in der Praxis keine Rolle!
W.S.: Da prallten zwei Welten aufeinander – die Innenwelt der Wissenschaft in ihrer kleinen Welt des Labors und der Forschungsparadigmen und die Außenwelt mit ihren Problemen der Erziehung, der Arbeit, der Gesundheits-, der Rechtspflege … Das konnte auf Dauer nicht gut gehen.
Also ein Krach? Eine Revolution?
W.S.: Der Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Psychologie hat es bei der Anhörung im Gesundheitsministerium im März einen Quantensprung genannt. Ich will nicht dramatisieren. Die Tatsachen sind die folgenden: Es kommt ein neues Psychotherapeutengesetz. Danach kann man sogleich nach fünf Studienjahren die staatliche Approbation für Psychotherapie erhalten – für Patienten aller Altersstufen. Voraussetzung ist: Man muss in den fünf Jahren die – wie es im Gesetz heißt – für eine psychotherapeutische Versorgungen erforderlichen grundlegenden Kompetenzen erworben haben. Die Kompetenzen erwirbt man in einem vom Gesundheitsminister verordneten Studienprogramm, das drei der fünf Studienjahre umfasst. In einer ersten Umfrage hat sich eine Mehrzahl der Universitätsinstitute in Deutschland bereit erklärt, das vom Ministerium verordnete Studium bis zum kommenden Jahr einzurichten. Viele Studierende, die Psychotherapeuten werden wollen, werden hoch zufrieden sein. Die ungeliebten Grundlagenfächer werden im Ministerprogramm auf einen Anstandsrest von insgesamt etwa einem halben Semester geschrumpft sein, schon im Grundstudium gibt es Praxisanteile – es geht also gleich los mit Psychotherapie satt.
Wird also aus dem Studium der Psychologie ein Studium der Psychotherapie?
W.S.: Der Gesundheitsminister selbst hat in einer Pressemitteilung den neuen Studiengang „Psychotherapie“ genannt und den Begriff „Psychotherapiewissenschaft“ verwendet. Der Fakultätentag Psychologie, der die deutschen Institute vertritt, will dafür Ressourcen des bisherigen Psychologiestudiums einsetzen. Das zukünftige fünfjährige Studium, das die Approbation voraussetzt, soll ein Bachelor-/Masterstudium der Psychologie sein – eben mit 60% heilkundlich relevanten Lehrveranstaltungen. Ein Studiengang Psychologie mit 60% Psychotherapie? Ich denke: Das kann doch nicht das weite Feld sein, auf dem man – wie ich vorhin zitierte – in beliebigem Zickzack große Strecken zurücklegt. Da wird´s doch eng. Und weil man auf dem engen Feld mehr Kapazität für Klinische Psychologie braucht, muss nichtklinische abgebaut werden.
Der Fakultätentag sieht das anders. Er sagt erstens: Die Institute brauchen ja nicht alle ihre Studienplätze für das approbationsgerechte Studium zu vergeben; sie können einen Teil für ein anderes, komplett polyvalentes – wie der Fakultätentag sagt – Studium vorsehen. Und zweitens: Es gibt ja noch 40% Studienzeit, die nicht für Psychotherapie reserviert ist; da kann man noch jede Menge andere, polyvalente – wie der Fakultätentag sagt – Psychologie unterbringen. Und drittens: Für den Mehrbedarf an Klinischer Psychologie gibt es neue Haushaltsmittel.
W.S.: Die Entscheidung darüber werden letztlich die Studierenden treffen. Schon jetzt ist die Nachfrage nach Ausbildung in Klinischer Psychologie groß. Und der Gesundheitsminister hat recht, wenn er vor der Presse verlautbart, die Approbation als Abschluss werde das neue Studium der Psychotherapie noch attraktiver machen. Wenn also ein Ansturm auf das approbationsfähige Psychotherapiestudium einsetzt und Plätze für einen nicht approbationsfähigen Psychologiemaster übrig bleiben, werden Universitätsverwaltungen und Verwaltungsgerichte dafür sorgen, dass umgeschichtet wird. Und zum Zweiten: Wenn die meisten angehende Psychotherapeuten nun einmal keinen Spaß an Grundlagen- und Methodenfächern sowie an nichtklinischen Anwendungen haben, dann werden sie ihre 40% vom Gesundheitsminister nicht beanspruchten Studienzeiten anderen Fächern widmen, die ihnen mehr Spaß machen und für ihren späteren Beruf mehr zu bringen versprechen: Zum Beispiel Familiensoziologie oder Interkulturelle Studien oder gender studies. Das erlaubt der Gesundheitsminister ausdrücklich. Denn er verlangt als Ergänzung zu seinem Pflichtprogramm ein Studium von Bezugswissenschaften. Psychologie ist eine dieser Bezugswissenschaften, aber eben auch nur eine von vielen wählbaren. Wie viele Wissenschaften stehen doch in Bezug zu einer Psychotherapie in der modernen Gesellschaft! Und zum dritten Punkt: Den Universitätskanzler gibt es wohl nicht, der für eine Reform der Psychotherapieausbildung mehr Geld ausgibt, wenn diese gleichzeitig im weiteren Bereich der Psychologie Einsparungen ermöglicht.
Also ein Ende der Psychologie! Gibt es da noch eine Rettung?
W.S.: Also erst einmal: Ich habe nicht den totalen Untergang der Psychologie vorhergesagt. Ich habe nur geschrieben: Die Psychologie hierzulande war bisher eine breitgefächerte, vielseitig anwendbare Einzeldisziplin. Damit ist Schluss, wenn die Psychotherapie jetzt rausgeht und sich als Psychotherapeutenberuf und als Psychotherapiewissenschaft – so steht das im Gesetz – verselbständigt. Insofern: Wende, Ende. Und hinzu kommt die Sorge: Bleibt genug für den Rest, wenn die Psychotherapie bei ihrem Auszug Ressourcen mitnimmt?
Sie haben gerade gesagt: Der Rest wird nicht groß sein, wird vielleicht gegen Null gehen, wenn sich alle Studierende nur auf Psychotherapie stürzen. Wenn dem so wäre, gäbe es bei uns bald nur mehr approbierte Psychotherapeuten.
W.S.: Mit einer bedeutsamen Einschränkung: Der Gesundheitsminister will die Zahl der Approbationen deckeln. Man spricht jetzt von knapp 3.000 Approbationen im Jahr. Wir haben gegenwärtig etwa 4.000 Masterabschlüsse. Das gibt entweder ein Hauen und Stechen um die Zulassung zur Approbation – und zwar erst nach Studienabschluss. Oder es wird bereits die Zulassung zum Psychotherapiestudium auf 3.000 landesweit gedeckelt. Dann bliebe freilich Kapazität übrig für nicht heilkundliche Psychologie.
Die könnte dann für die Ausbildung in Wirtschaftspsychologie, Schulpsychologie usw. eingesetzt werden.
W.S.: Ja, aber wieder mit einer Einschränkung: Das müssen die Studierenden wirklich wollen. Sie dürfen nicht Druck machen und eine Erhöhung der Zulassungen zum Psychotherapiestudium und zur Approbation fordern. Wir brauchen keine psychologischen Studiengänge für junge Leute, die frustriert sind, weil sie nicht zum Studium der Psychotherapie zugelassen wurden. Das ist es, was mich am Konzept des polyvalenten Studiums stört, das neben dem Psychotherapiestudium angeboten werden soll: Es kann allzu leicht negativ bestimmt werden – als Psychologie, die alles ist nur keine Psychotherapie. Bei der verbreiteten Erwartungshaltung ist das wie Kuchen ohne Rosinen.
Das gilt auch für Auftrag- und Arbeitgeber. Wenn ein polyvalent ausgebildeter Psychologe mit einem Mastergrad bei einem Auftrag- oder Arbeitgeber erscheint, der ein wenig Bescheid weiß, wird der möglicherweise fragen: Warum hat der keine Approbation? Soll ich nicht lieber einen Psychologen mit Approbation nehmen?
W.S.: Das vermeidet man, wenn man Studiengänge und Abschlüsse positiv bestimmt. Etwa durch bedeutsame Anwendungsfelder: Erziehung, Arbeit, Markt, Verkehr, Recht. Da gibt es viele Optionen, und man braucht das nicht knapp zuzuschneiden. Da kann man Cluster bilden – zum Beispiel Personalentwicklung, Training, Coaching, Marketing u. Ä.. Eine solche Aufzählung ist selbstverständlich viel zu umständlich. Da muss ein einheitliches Konzept her wie für ein neues Produkt, und ein neues Produkt braucht einen schlagkräftigen Namen, gern ein Anglizismus –beispielsweise für den genannten Cluster: Human economics / Humanwirtschaft. Klingt schrecklich, aber irgendwie so …
Ähnlich müsste es auch gehen in einem Cluster Erziehung/ Bildung/ Medien. Ich weiß, es gibt bereits Überlegungen zu einem weiteren Studiengang Human Engineering / Cognitive Ergonomics. Ein Cluster braucht nicht an allen Orten vertreten zu sein, aber doch wenigstens dauerhaft paarmal im Land. Dafür könnte man selbstbewusst werben, und wenn´s glückt, Studenten anziehen, die es begeistert. Und dann hat man sowohl Studierende als auch Abnehmer, welche die Ausbildung zu schätzen wissen.
Human Economics, Human Engineering – nicht Wirtschaftspsychologie, Arbeitspsychologie? Gibt es dann gar kein Studium mit „Psychologie“ mehr?
W.S.: Name ist Schall und Rauch. Oder ist nomen doch omen? Ich habe die Mode der Neubenennungen nicht erfunden. Ich habe mich als experimenteller Psychologie nie Hirnforscher genannt. Aber neue Namen schwirren herum und signalisieren Originalität, Eigenständigkeit. Was viel gravierender ist, als solche Sprachspiele: Ich schlage gerade vor, für einzelne Anwendungsfelder eigene Studiengänge zu konstruieren. Dabei führe ich gedanklich fort, was mit dem Auszug der Psychotherapie begonnen hat, und lande bei einer weiteren Teilung der Psychologie als einheitlicher Disziplin. Und Sie haben richtig bemerkt: Dabei geht ganz schnell die Bezeichnung Psychologie verloren. Aber Sie haben gefragt: Gibt es noch eine Rettung? Und ich antworte: Für unsere großen Anwendungsfelder könnte das eine Rettung sein.
Die bisherige Bachelor-/Masterausbildung in Fortführung der Diplomausbildung ist Ihrer Meinung nach ein Auslaufmodell?
W.S.: Ja.
Und damit auch der akademisch gebildete All-Round-Psychologe?
W.S.: Ja.
Ich bin erstaunt. Sie argumentieren gar nicht mehr wissenschaftsimmanent. Sie sprechen gar nicht mehr – wie vorhin – von einem großen Feld, in dem man wandert und springt zum eigenen Vergnügen. Sie argumentieren wie ein Unternehmensberater, der eine Firma zerlegt, um sie besser zu vermarkten.
W.S.: Oder um die Firma zu retten. Danach haben Sie doch gefragt: Gibt es eine Rettung für die Psychologie als akademisches Fach? Warum kann sie denn nicht weitermachen wie bisher? Weil sich ihre Bestandsbedingungen geändert haben. Es heißt nicht mehr: Ist sie sich selbst genug? Es heißt: Wie wird sie nachgefragt? Ja, wir sind ein Marktobjekt. Und die Psychotherapie ist – marktwirtschaftlich gesprochen – unser Filetstück. Die Psychotherapie ist die Task Force der Gesellschaft gegen psychische Störungen. Und psychische Störungen haben Karriere gemacht in unserer Gesellschaft: Nach Gesundheitssurvey machen sie 30% aller Erkrankungen von Erwachsenen aus. Laut Swiss Life, dem Lebensversicherer, sind in Deutschland 37% der Fälle vorzeitiger Berufsunfähigkeit psychisch bedingt. Das kostet Milliarden an Arbeitsausfällen, für Therapie und Rehabilitation. Deshalb hat auch der Gesundheitsminister eingegriffen. Nun geht das Filetstück weg. Und wir müssen erkennen: Es war der Garant unseres Wachstums.
Wie meinen Sie das? Welches Wachstum meinen Sie?
W.S.: Ich meine das Wachstum der Psychologie an den deutschen Hochschulen. Gegenwärtig studieren rund 80.000 Personen Psychologie. In den 1960er-Jahren waren es keine 10.000. Entsprechend ist das Lehrpersonal gewachsen auf rund 1.000 Professoren und 3.000 weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Von dem Wachstum haben aber doch alle Fächer profitiert.
W.S.: Das ist doch das Problem. Die Studierenden sind zu tausenden in das Studium der Psychologie gekommen, und wir haben ihnen experimentalpsychologische Praktika und Statistikveranstaltungen und viele Grundlagen angeboten. Aber die meisten wollten das gar nicht. Die wollten Psychotherapie. Und um Weiterbildung in Psychotherapie zu bekommen, mussten sie vorher das Psychologendiplom machen. Das war zunächst nicht bindend, doch ab 1998 durch das erste Psychotherapeutengesetz so geregelt. Und weil sie das Diplom wollten oder brauchten, haben sie die ungeliebten Veranstaltungen absolviert. Wir sprachen doch am Anfang davon. Je mehr Hörer und Prüflinge ich hatte, desto mehr kamen nur, weil sie meine Scheine und Noten wollten. Andererseits: Je mehr sich einschrieben, desto mehr Stellen bekamen wir. Der Ansturm auf die polyvalente Psychologie war eine sehr nützliche Illusion. Und die Illusion war auch selbstdienlich, weil wir uns ein wenig schmeicheln konnten, wir seien attraktiv, weil alle unsere Wissenschaft so gut war.
Doch warum diese Trennung von Psychologie und Psychotherapie? Ist Psychotherapie nicht aus der Psychologie hervorgegangen? Der Wissenschaftsrat hat ja kürzlich erst festgestellt: Psychologie ist die Mutterdisziplin der Psychotherapie.
W.S.: Da muss ich weiter ausholen. Da muss ich erst einmal etwas sagen zur Schichtung der Psychologie. Psychologie ist ja ein Kulturphänomen, sie steckt erst einmal in unserer Sprache und unseren Bräuchen. Mein Lehrer Fritz Heider nannte das „Naive Psychologie“, und damit war überhaupt nichts Abschätziges gemeint. Naiv bedeutete nur implizit, also nicht zur Sprache gebracht. Das ist die erste Schicht. Nun kommen Gelehrte und machen Psychologie explizit; sie bringen sie auf Begriffe und zur Sprache, suchen sie zu ergründen und zu erweitern. Die doctores und professores, die an den höheren Lehranstalten ihr Brot verdienen, sind kluge Leute, manche richtige Hochleistungsintellektuelle. Aber sie sind selbstbewusst, igeln sich ein in ihren akademischen Institutionen, ergänzen sich meist durch Berufung von Gleichgesinnten und Nachwuchspflege. Sie ereifern sich über Prinzipien, streben nach Generalisierung. Dafür ist die Welt zu komplex. Daher abstrahieren sie die Wirklichkeit in ihrem Denken und vereinfachen sie in ihren Laboratorien. So gelangen sie zu eindrucksvollen Erkenntnissen und nennen diese Wissenschaft. Das ist eine zweite Schicht. Zwischen naiver und wissenschaftlicher Psychologie bleibt viel Raum. Da siedelt sich eine weitere Schicht an, die bezeichne ich in Anlehnung an den von mir sehr geschätzten Max Dessoir „Popularpsychologie“. Das ist wieder nicht abschätzig gemeint, sondern höchst respektvoll. Es ist die Psychologie der Bürgergesellschaft, die im 19. Jahrhundert einen gewaltigen Aufschwung nimmt. Erzieher, Geistliche, Ärzte, Justizbeamte und Andere diskutieren und schreiben da über „Seelennatur-, Seelenkrankheits- und Seelenheilkunde“. Die Kunst nimmt regen Anteil und überhaupt die Öffentlichkeit. So kommen Konzepte wie „Unbewusstes“ auf. Berater, Lehrer, Nervenärzte propagieren eigene Theorien und Methoden. Es entstehen Richtungen wie die Psychagogik und die Psychoanalyse.
Die Wissenschaft an den akademischen Institutionen hat sich gegenüber diesen Richtung weit überwiegend distanziert oder sogar ablehnend verhalten. Kognitive Richtung erschienen zu wenig originell, weil sie bekannte antike Redekünste zur Sinngebung und Wertsetzung auffrischen; psychoanalytische Richtungen waren mit scharfsinnigen, mitunter an Tabus rührenden Annahmen über das Unbewusste originell, doch erschienen sie zu spekulativ. Die psychoanalytische Bewegung zog aus der Ablehnung eine doppelte Konsequenz: Sie richtete eigene Ausbildungsinstitute ein und ließ zur Ausbildung auch Laien zu, insbesondere ärztliche Laien. Aus einer popularpsychologischen Bewegung ging also eine Expertengruppe mit eigenen Konzepten und eigener Praxis hervor. Doch sie organisierte sich privat, blieb jedenfalls vor den Toren der akademischen Institutionen. Oder doch nicht ganz? Die Nervenärzte unter den Experten waren ebenfalls akademisch ausgebildet, durften sich „Doktor“ nennen. Im Unterschied zu den anderen, den nicht-ärztlichen Beratern und Therapeuten.
Ich erzähle hier lange und doch recht verkürzt.
Das ist schon in Ordnung. Das kann man in Ihrer „Geschichte und Systematik“ ausführlich nachlesen und in knapper Form in Ihrem Kurzlehrlehrbuch „Psychologie – historisch betrachtet“. Der Springer Verlag hat mir erlaubt, das Kapitel „Psychotherapie als Heilberuf“ als Leseprobe zu verlinken unter: https://psyche-und-arbeit.de/?page_id=13028. Da kann man also nachlesen: Sie unterscheiden eine Psychologie im akademischen Format und daneben eine aus Praxis hervorgehende Expertenpsychologie. Diese Auffassung ist sicherlich nicht mainstream. Der mainstream bevorzugt das Scientist-Practitioner-Modell. Das Modell verknüpft Ihre beiden Schichten: Die Expertenpsychologie aus der Praxis bringt ihre Konzepte in den Kontext der akademisch gepflegten Theorie ein, profitiert von ihren Methoden und steigert damit ihre Qualität. Eine doppelte win-Situation übrigens, weil die akademischen Vertreter ihrerseits einen theoretisch-methodischen Input erhalten, ihren Realismus erhöhen und ihre gesellschaftliche Relevanz.
W.S.: Der Begriff Scientist-Practitioner stammt aus den USA der 1930er-Jahre, und er war nicht zuletzt auf das dortige „clinical movement“ gemünzt. Es ging darum, an Universitäten als Alternative zu den psychologischen Laboratorien „psychological clinics“, also Ambulatorien zur psychologischen Beratung und Behandlung zu schaffen. Dabei galt in der Tat die Idealvorstellung, Praxis wissenschaftlich zu begründen und Wissenschaft durch Konfrontation mit praktischen Problemen lebensnäher zu gestalten. Die klinische Bewegung umfasste neben Erziehungsberatung auch Behandlung von Störungen – oft schwer zu unterscheiden. Um Protagonisten wie Aaron T. Beck bildeten sich eigene Gruppen, genannt „Schulen“. Die so in den USA aufkommende, immer stärker werdende Klinische Psychologie breitete sich dann seit den 1970er-Jahren auch in Europa und in Deutschland aus. Die Universitäten richteten Professuren für Klinische Psychologie ein, ja sogar „clinics“ für ambulante Behandlungen. Berufenere als ich müssen feststellen, wie weit damit die Idealvorstellung der wissenschaftlich fundierten Praxis verwirklicht wurde.
Das klingt sehr skeptisch. Haben Sie Zweifel?
W.S.: Der praktische Nutzen der Klinischen Psychologie ist unbestreitbar. Über ihre wissenschaftliche Fundierung will ich mir wirklich kein Urteil erlauben. Aber ein wenig sauer bin ich schon. Wir haben ja schon zu Beginn von meinen Schwierigkeiten mit Studenten gesprochen und deren Schwierigkeiten mit mir. Ich habe mich bemüht, gute Wissenschaft zu vermitteln. Und wie oft habe ich hören müssen: Nein danke – wir interessieren uns mehr für Klinische. Und dann habe ich gefragt: Warum seid ihr hier? Und so bin ich zur Erklärung gelangt: Man kann den Scientist-Practitioner unter zwei Aspekten sehen, einem genuinen und einem sozialen. Unter dem genuinen Aspekt verbindet er Wissenschaft und Praxis; dabei treiben sich Wissenschaft und Praxis gegenseitig. Unter dem sozialen Aspekt ist der Scientist-Practioner ein Praktiker, der zugleich einen Platz unter den Wissenschaftlern hat.
Also er ist Wissenschaftler und Praktiker, aber seine Praxis hat nicht unbedingt etwas mit seiner Wissenschaft zu tun. Und was bringt das?
W.S.: Akademisch betriebene Wissenschaft ist ja ein Prestigeobjekt und in vielen Bereichen ein ungeheurer Fortschrittsmotor. Seitdem Preußen ein Staatsexamen eingeführt hat, mit dem sich Juristen für den Staatsdienst qualifizieren können, haben immer mehr akademische Fächer berufsqualifizierende Studienabschlüsse eingeführt und damit ihren Absolventen eine berufliche Laufbahn eröffnet. Die Psychologie ist gefolgt – zunächst mit ihrer Diplomprüfung. Die psychologischen Berater und Behandler hatten nun lange zwei Probleme: Ein äußeres Problem: Es fehlte dem Beruf die formelle akademische Anerkennung. Allerdings galt das nicht für alle Vertreter des Berufs in gleicher Weise. Denn einige waren als Ärzte ausgewiesen, verfügten also über eine akademische Zugehörigkeit. Das schuf wiederum ein inneres Problem: Ungleichheit von ärztlichen und nicht-ärztlichen Psychotherapeuten. Um gleichzuziehen, absolvierten die Nichtmediziner ein anderes Studium, vorzugsweise Psychologie, das ja nach populärem Verständnis den Rahmen der Psychotherapie bildet. So bekamen alle einen akademischen Status. Diese Regelung war viele Jahre informell. Doch 1998 wurde – wie bereits erwähnt – die Regelung in Deutschland gesetzlich, kurz danach ebenfalls in Österreich. Der Beruf des Psychotherapeuten für Erwachsene setzt seitdem ein Studium der Psychologie voraus. Für Kinder- und Jugendpsychotherapie wurde ein Studium der Pädagogik Voraussetzung. Leider stimmte das populäre Verständnis von Psychologie nicht mit dem überwiegenden Selbstverständnis der akademischen Psychologie an den Universitäten überein, und so kam es zu dem quälenden Nebeneinander.
Insofern ist es konsequent, wenn sich die Psychotherapie nun mit einem eigenen Studiengang verselbständigt.
W.S.: Ja. Es tut nur den Anderen weh, wenn damit so viele Mittel von der verbleibenden Psychologie abgezogen werden.
Wir sprechen von der Rettung der verbleibenden Psychologie. Sie sehen eine Aussicht auf Rettung für psychologische Studiengänge mit klarem Fokus auf Praxisbereiche wie Arbeit/Wirtschaft oder Erziehung/Bildung. Haben wir es da nicht auch mit der von Ihnen beschriebenen Schichtung zu tun?
W.S.: Selbstverständlich. Es gab und gibt doch Lehrer, Ökonomen, Richter, die sind gute Psychologen, ohne Psychologie studiert zu haben. Ihre Expertise schlägt sich in selbständigen Lehren nieder wie Pädagogik und Arbeitswissenschaft, aber auch in psychologischen Spezialdisziplinen wie Pädagogische Psychologie und Arbeitspsychologie.
Und wie beurteilen Sie das Wissenschafts-Praxis-Verhältnis in diesen Disziplinen – eher genuin oder eher sozial?
W.S.: Beziehungen sind immer auch Sozialbeziehungen. Aber hier sehe ich doch mehr genuine Wissenschafts-Praxis-Beziehungen, Synergien. Insbesondere gibt es engere Verbindungen zu Grundlagenfächern wie Entwicklungs- und Sozialpsychologie, Kognitions- und Handlungspsychologie, mehr Aufmerksamkeit für nicht intuitive wissenschaftliche Methoden.
Nun sind wir zu den Grundlagen- und Methodenfächern gekommen. Sind die zu retten als Teile von praxisfokussierten Studiengängen?
W.S.: Das könnte ein Weg sein.
Und ein eigener Studiengang „Psychologische Grundlagen und Methoden“?
W.S.: Das wäre schön. Aber immer wieder: Dafür muss man Studierende gewinnen. Das können wir nur, wenn wir ihnen eine berufliche Perspektive bieten. Dafür reicht der Personalbedarf der Hochschulen allein nicht. Wenn Hochschulen nur für die Hochschullaufbahn ausbilden, produzieren sie zu viele frustrierte Privatdozenten. Aber es gibt eine Perspektive außerhalb der Hochschulen. Die Bundesregierung und die Wirtschaft investieren viel Geld in außeruniversitäre Forschungsinstitute – etwa die nach Leibniz, Max Planck, Fraunhofer benannten. Außeruniversitäre Forschung – das könnte für Absolventen eines auf Grundlagen und Methoden fokussierten Psychologiestudiums das rettende Ufer sein.
Eine persönliche Frage zum Schluss: Sind Sie sehr enttäuscht, Herr Schönpflug? Es geht ja auch um Ihr Lebenswerk.
W.S.: Ich klage nicht. Ich bin ja kein Akteur mehr. Ich bin nur noch Betrachter. Ich beobachte und analysiere – aus einer historischen Perspektive, auf einer Metaebene. Ich bin überzeugt: Rekonstruktion der Vergangenheit ist gut für die Diagnose der Gegenwart. Wenn es mir gelingt, das zu vermitteln, bin ich zufrieden. Vielleicht hilft das den aktiven Kolleginnen und Kollegen, das Bestmögliche aus der gegenwärtigen Situation zu machen.
Wolfgang Schönpflug
- Geboren 1936 in Berlin. Studium der Psychologie, Physiologie, Betriebswirtschaftslehre an der University of Kansas, Lawrence, Kansas (USA) und Frankfurt am Main.
- Wissenschaftlicher Assistent an den Universitäten Frankfurt a. M. (Prof. Rausch) und Bochum (Prof. Heckhausen). 1967 Dozent, 1969 Wissenschaftlicher Rat und Professor an der Universität Bochum. Seit 1974 Professor für Psychologie (Schwerpunkt Allgemeine Psychologie) an der Freien Universität Berlin (seit 2003 emeritiert).
- Mitwirkung in örtlichen und überregionalen Studienreformkommissionen. Erster Vorsitzender der Sektion Ausbildung (jetzt: Aus-, Fort- und Weiterbildung) des Berufsverbands deutscher Psychologen (jetzt: Psychologinnen und Psychologen). 2016 Goldene Ehrennadel des Berufsverbandes deutscher Psychologinnen und Psychologen.
Literaturhinweise:
- Schönpflug, W. (2006). Einführung in die Psychologie. Weinheim: BeltzPVU (2012 Lizenzausgabe Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft).
- Schönpflug, W. (2013). Geschichte und Systematik der Psychologie. Weinheim: Beltz (dritte, neu bearbeitete Auflage).
- Schönpflug, W. (2016). Psychologie – historisch betrachtet. Wiesbaden: Springer.
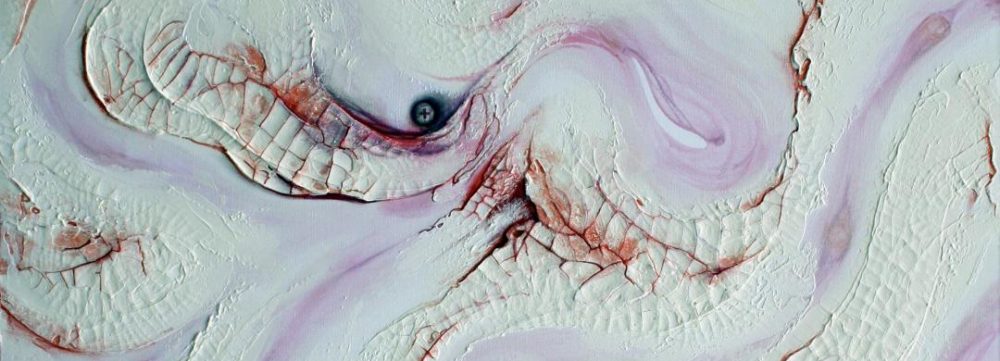

 Wolfram Kölling ist Diplom-Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut mit jahrzehntelanger Erfahrung als Gruppen- und Seminarleiter. Er war siebzehn Jahre Leitender Psychologe in einer Psychosomatischen Klinik. Nach intensiven Fort- und Weiterbildungen sowie Selbsterfahrungen u.a. in Kathatym Imaginativer Psychotherapie (KIP), Primärtherapie, Holotropen Atmen, Gestalttherapie und EMDR hat er sich vor allem mit dem Studium schwerer Schamkonflikte und Persönlichkeitsstörungen beschäftigt. In einem eigenen Ansatz der Arbeit mit inneren Einstellungen verbindet er traditionelle Psychotherapie mit den Erkenntnissen einer Integralen Transpersonalen Psychologie.
Wolfram Kölling ist Diplom-Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut mit jahrzehntelanger Erfahrung als Gruppen- und Seminarleiter. Er war siebzehn Jahre Leitender Psychologe in einer Psychosomatischen Klinik. Nach intensiven Fort- und Weiterbildungen sowie Selbsterfahrungen u.a. in Kathatym Imaginativer Psychotherapie (KIP), Primärtherapie, Holotropen Atmen, Gestalttherapie und EMDR hat er sich vor allem mit dem Studium schwerer Schamkonflikte und Persönlichkeitsstörungen beschäftigt. In einem eigenen Ansatz der Arbeit mit inneren Einstellungen verbindet er traditionelle Psychotherapie mit den Erkenntnissen einer Integralen Transpersonalen Psychologie.


 Prof. Dr. (em.) Bernd Gasch, geb. 1941, Dipl-Psych. Promotion an der Universität Erlangen. Tätig in Augsburg, Mannheim. Seit 1979 Professur an der Universität Dortmund, Forschungsaufenthalte in Mailand, Australien, USA. Forschungsgebiete: Pädagogische Psychologie, Organisationspsychologie, Notfallpsychologie.
Prof. Dr. (em.) Bernd Gasch, geb. 1941, Dipl-Psych. Promotion an der Universität Erlangen. Tätig in Augsburg, Mannheim. Seit 1979 Professur an der Universität Dortmund, Forschungsaufenthalte in Mailand, Australien, USA. Forschungsgebiete: Pädagogische Psychologie, Organisationspsychologie, Notfallpsychologie.





